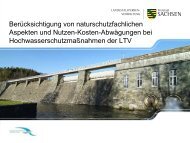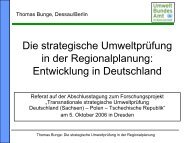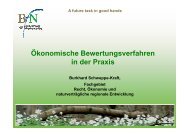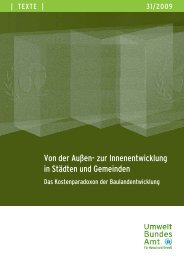Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
110 IÖR Schriften │ Band 49 • 2008 <strong>Dichte</strong> <strong>und</strong> <strong>Schrumpfung</strong> – Christiane Westphal<br />
chen Hülle oder Fläche gegenüber, insbesondere wenn an den Stadträndern weiter<br />
neue Baugebiete entstehen (DOEHLER 2003b, 310). Die perforierte Stadt ist dadurch<br />
gekennzeichnet, dass Wachstum <strong>und</strong> <strong>Schrumpfung</strong> häufig kleinteilig nebeneinander<br />
erfolgen. Es entsteht eine unmittelbare Nähe von robusten <strong>und</strong> subsistenten Kernen<br />
<strong>und</strong> stagnierenden, brachfallenden Gebieten mit schlechten Entwicklungsaussichten<br />
(LÜTKE DALDRUP 2003, 2).<br />
Exkurs 7: Handlungsoptionen <strong>für</strong> die perforierte Stadt am Beispiel von Leipzig<br />
Das Planungskonzept der „Perforierten Stadt“ hat seinen wesentlichen Ursprung in den Planungen<br />
der Stadt Leipzig, deren Vertreter gewissermaßen eine Vorreiterrolle in der frühzeitigen<br />
Auseinandersetzung mit <strong>Schrumpfung</strong>sprozessen eingenommen haben (VOGLER 2003,<br />
96). Am Beispiel von Leipzig beschreibt LÜTKE DALDRUP (2001, 42) die Auflösung städtischer<br />
Blockstrukturen in ein „Stadtbild der hohlen Zähne“, die Entstehung eines durch Verdünnung<br />
der Nutzungen lockeren Stadtgewebes sowie das Einsickern patchworkartiger Peripheriestrukturen<br />
in die innere Stadt. Vor allem an den stadtbildprägenden Magistralen, die besonders<br />
durch Verkehrslärm belastet sind, entstehen Risse zwischen den konsolidierten Stadtschollen<br />
(LÜTKE DALDRUP 2001, 44).<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird auch in der perforierten Stadt Leipzig am Konzept einer nachhaltigen,<br />
kompakten, europäischen <strong>und</strong> sozial gemischten Stadt festgehalten. Ziel ist die Verbesserung<br />
der Konkurrenzfähigkeit innerstädtischer Quartiere durch eine Anreicherung ehemals<br />
dichter Quartiere mit ökologisch <strong>und</strong> sozial nutzbarem Freiraum. Allerdings gibt es innerhalb<br />
der Stadt Gebiete, die in ihrer gegenwärtigen baulichen Struktur nicht mehr zukunftsfähig<br />
sind <strong>und</strong> von der Stadt Leipzig als Umstrukturierungsgebiete bezeichnet werden. Für diese<br />
Bereiche gilt, dass eine Loslösung von herkömmlichen Leitbildvorstellungen erforderlich ist.<br />
„Die seit drei Jahrzehnten gepflegte städtebauliche Syntax von Baublock <strong>und</strong> behutsamer<br />
Ergänzung der tradierten Strukturen“ trägt in diesen städtischen Gebieten nicht mehr (LÜTKE<br />
DALDRUP 2001, 45).<br />
Während <strong>für</strong> Erhaltungsgebiete in Leipzig die Zielrichtung besteht, Blockstrukturen aktiv zu<br />
stützen <strong>und</strong> deren Innenbereiche zur Steigerung der Wohnqualität weitgehend zu begrünen,<br />
sollen in den Umstrukturierungsgebieten Strategien <strong>für</strong> einen differenzierten Einsatz von<br />
Umnutzung <strong>und</strong> Abriss entwickelt werden. Hier wird angestrebt erhaltbare Kerne zu stabilisieren,<br />
die von einem flexiblen <strong>und</strong> veränderbaren Stadtplasma umgeben sind. Leerstand<br />
<strong>und</strong> Rückzug sollen als Potenzial <strong>für</strong> neue kreative Nischen, Nutzungen <strong>und</strong> Freiräume aktiviert<br />
werden (LÜTKE DALDRUP 2001, 44).<br />
Für die Großsiedlungen gilt die Leitidee „Mehr Qualität durch weniger Häuser“, also eines<br />
Umbaus zu grünen Wohnsiedlungen am Stadtrand mit verringerter <strong>Dichte</strong> (LÜTKE DALDRUP<br />
2001, 44). Der Umbau der Platte wird aus zwei Komponenten bestehen der punktuellen<br />
Intervention in einzelnen Gebäuden <strong>und</strong> einer konzentrierten Umstrukturierung in den besonders<br />
hoch verdichteten Wohnkomplexen. Die Zielrichtung des Umbaus ist dabei von<br />
„außen nach innen“, um die „kompakte Stadt mit klaren Grenzen zur Landschaft zu festigen“<br />
(Lütke Daldrup 2001, 45).<br />
Mit diesen Ansätzen soll eine ungesteuerte Abwärtsspirale vermieden <strong>und</strong> zu einer hohen<br />
Lebensqualität in den verschiedenen Quartieren der schrumpfenden Stadt beigetragen werden<br />
(LÜTKE DALDRUP 2001, 45).<br />
Über eine Zustandsbeschreibung hinaus liefert der Begriff der perforierten Stadt<br />
auch einen „Ausblick“ (DOEHLER 2003a, 6): Als Entwicklungsimpuls sollte anerkannt<br />
werden, dass sich ein Großteil der in unseren Städten entstandenen Lücken nicht<br />
wieder füllen wird <strong>und</strong> es zu einer weiteren Auflösung des städtebaulichen <strong>und</strong> architektonischen<br />
Zusammenhangs kommen wird (DOEHLER 2003a, 6). In diesem<br />
Zusammenhang stellt LÜTKE DALDRUP (2001, 43) fest, dass angesichts der derzeitigen<br />
Rahmenbedingungen in ostdeutschen Städten „ein Loslösen von alten städtebaulichen<br />
Wachstums- <strong>und</strong> <strong>Dichte</strong>vorstellungen unumgänglich ist.“ Die durch Abriss<br />
<strong>und</strong> Verfall entstehenden Brachen stellen nicht nur einen Missstand, sondern gleichermaßen<br />
eine Chance <strong>für</strong> die Steigerung der Lebensqualität in innerstädtische