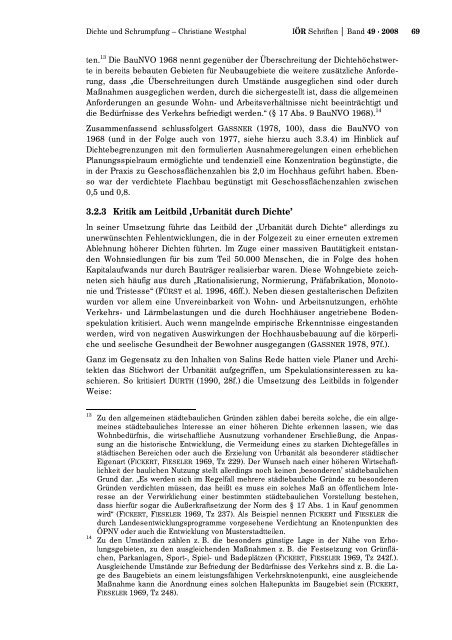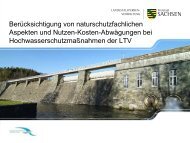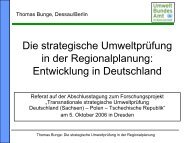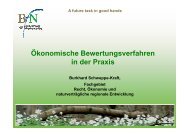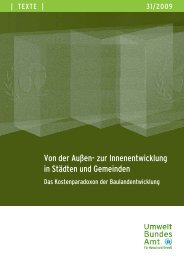Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Dichte</strong> <strong>und</strong> <strong>Schrumpfung</strong> – Christiane Westphal IÖR Schriften │ Band 49 • 2008 69<br />
ten. 13 Die BauNVO 1968 nennt gegenüber der Überschreitung der <strong>Dichte</strong>höchstwerte<br />
in bereits bebauten Gebieten <strong>für</strong> Neubaugebiete die weitere zusätzliche Anforderung,<br />
dass „die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch<br />
Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen<br />
Anforderungen an ges<strong>und</strong>e Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt <strong>und</strong><br />
die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden.“ (§ 17 Abs. 9 BauNVO 1968). 14<br />
Zusammenfassend schlussfolgert GASSNER (1978, 100), dass die BauNVO von<br />
1968 (<strong>und</strong> in der Folge auch von 1977, siehe hierzu auch 3.3.4) im Hinblick auf<br />
<strong>Dichte</strong>begrenzungen mit den formulierten Ausnahmeregelungen einen erheblichen<br />
Planungsspielraum ermöglichte <strong>und</strong> tendenziell eine Konzentration begünstigte, die<br />
in der Praxis zu Geschossflächenzahlen bis 2,0 im Hochhaus geführt haben. Ebenso<br />
war der verdichtete Flachbau begünstigt mit Geschossflächenzahlen zwischen<br />
0,5 <strong>und</strong> 0,8.<br />
3.2.3 Kritik am Leitbild ‚Urbanität durch <strong>Dichte</strong>’<br />
In seiner Umsetzung führte das Leitbild der „Urbanität durch <strong>Dichte</strong>“ allerdings zu<br />
unerwünschten Fehlentwicklungen, die in der Folgezeit zu einer erneuten extremen<br />
Ablehnung höherer <strong>Dichte</strong>n führten. Im Zuge einer massiven Bautätigkeit entstanden<br />
Wohnsiedlungen <strong>für</strong> bis zum Teil 50.000 Menschen, die in Folge des hohen<br />
Kapitalaufwands nur durch Bauträger realisierbar waren. Diese Wohngebiete zeichneten<br />
sich häufig aus durch „Rationalisierung, Normierung, Präfabrikation, Monotonie<br />
<strong>und</strong> Tristesse“ (FÜRST et al. 1996, 46ff.). Neben diesen gestalterischen Defiziten<br />
wurden vor allem eine Unvereinbarkeit von Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsnutzungen, erhöhte<br />
Verkehrs- <strong>und</strong> Lärmbelastungen <strong>und</strong> die durch Hochhäuser angetriebene Bodenspekulation<br />
kritisiert. Auch wenn mangelnde empirische Erkenntnisse eingestanden<br />
werden, wird von negativen Auswirkungen der Hochhausbebauung auf die körperliche<br />
<strong>und</strong> seelische Ges<strong>und</strong>heit der Bewohner ausgegangen (GASSNER 1978, 97f.).<br />
Ganz im Gegensatz zu den Inhalten von Salins Rede hatten viele Planer <strong>und</strong> Architekten<br />
das Stichwort der Urbanität aufgegriffen, um Spekulationsinteressen zu kaschieren.<br />
So kritisiert DURTH (1990, 28f.) die Umsetzung des Leitbilds in folgender<br />
Weise:<br />
13 Zu den allgemeinen städtebaulichen Gründen zählen dabei bereits solche, die ein allgemeines<br />
städtebauliches Interesse an einer höheren <strong>Dichte</strong> erkennen lassen, wie das<br />
Wohnbedürfnis, die wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Erschließung, die Anpassung<br />
an die historische Entwicklung, die Vermeidung eines zu starken <strong>Dichte</strong>gefälles in<br />
städtischen Bereichen oder auch die Erzielung von Urbanität als besonderer städtischer<br />
Eigenart (FICKERT, FIESELER 1969, Tz 229). Der Wunsch nach einer höheren Wirtschaftlichkeit<br />
der baulichen Nutzung stellt allerdings noch keinen ‚besonderen’ städtebaulichen<br />
Gr<strong>und</strong> dar. „Es werden sich im Regelfall mehrere städtebauliche Gründe zu besonderen<br />
Gründen verdichten müssen, das heißt es muss ein solches Maß an öffentlichem Interesse<br />
an der Verwirklichung einer bestimmten städtebaulichen Vorstellung bestehen,<br />
dass hier<strong>für</strong> sogar die Außerkraftsetzung der Norm des § 17 Abs. 1 in Kauf genommen<br />
wird“ (FICKERT, FIESELER 1969, Tz 237). Als Beispiel nennen FICKERT <strong>und</strong> FIESELER die<br />
durch Landesentwicklungsprogramme vorgesehene Verdichtung an Knotenpunkten des<br />
ÖPNV oder auch die Entwicklung von Musterstadtteilen.<br />
14 Zu den Umständen zählen z. B. die besonders günstige Lage in der Nähe von Erholungsgebieten,<br />
zu den ausgleichenden Maßnahmen z. B. die Festsetzung von Grünflächen,<br />
Parkanlagen, Sport-, Spiel- <strong>und</strong> Badeplätzen (FICKERT, FIESELER 1969, Tz 242f.).<br />
Ausgleichende Umstände zur Befriedung der Bedürfnisse des Verkehrs sind z. B. die Lage<br />
des Baugebiets an einem leistungsfähigen Verkehrsknotenpunkt, eine ausgleichende<br />
Maßnahme kann die Anordnung eines solchen Haltepunkts im Baugebiet sein (FICKERT,<br />
FIESELER 1969, Tz 248).