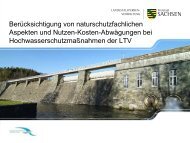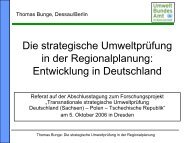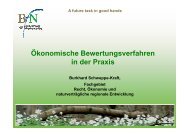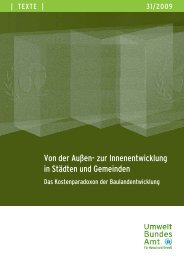Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Dichte und Schrumpfung - Leibniz-Institut für ökologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Dichte</strong> <strong>und</strong> <strong>Schrumpfung</strong> – Christiane Westphal IÖR Schriften │ Band 49 • 2008 145<br />
nach einhelliger Meinung ein zentraler Faktor der Wohnqualität (GÄLZER 2001, 23ff.;<br />
NOHL 1993, 3ff.; NOHL, ZEKOM 1995, 9ff.; RITTER 1995, 317; SENSTADT BERLIN<br />
1996a, 06.03, 1).<br />
<strong>Dichte</strong> als Einflussfaktor der Freiraumversorgung<br />
Die Freiraumversorgung ist sowohl abhängig vom quantitativen Angebot an erholungsgeeigneten<br />
Freiräumen in fußläufiger Entfernung als auch von qualitativen<br />
Merkmalen wie deren Größe, Zugänglichkeit, Vielfältigkeit der Ausstattung <strong>und</strong> Gestaltung<br />
<strong>und</strong> deren Belastung durch Immissionen (HUTTER et al. 2004, 98).<br />
Die <strong>Dichte</strong> hat einen wesentlichen Einfluss auf die Freiraumversorgung. Dabei hängt<br />
die Freiraumversorgung in zweierlei Weise von der <strong>Dichte</strong> ab: Während die Bebauungsdichte<br />
wesentlich <strong>für</strong> das potenzielle Angebot an Grün- <strong>und</strong> Freiflächen ist, bestimmt<br />
die Einwohnerdichte die Nachfrage nach diesen Flächen.<br />
Daher kommt es gerade in verdichteten Wohngebieten zu einem Mangel an Freiflächen,<br />
da hier ein durch hohe Bebauungsdichten verursachter Freiflächenmangel mit<br />
einer hohen Nachfrage nach Freiräumen zusammen trifft (NOHL 1993, 7ff.; NOHL,<br />
ZEKOM 1995, 47).<br />
Private <strong>und</strong> halböffentliche Freiräume<br />
Private <strong>und</strong> halböffentliche Freiräume werden hier nicht eigentumsrechtlich, sondern<br />
im Hinblick auf ihre Nutzbarkeit definiert (RÖßLER 2003, 34). Demnach zählen zum<br />
privaten Freiraum die privaten Gärten der Einfamilienhaus- <strong>und</strong> Reihenhausbebauung<br />
sowie Dachgärten, Terrassen <strong>und</strong> Balkone (RICHTER 1981, 16). Halböffentliche<br />
oder auch gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen sind nur einem eingeschränkten<br />
Nutzerkreis zugänglich <strong>und</strong> gegenüber dem öffentlichen Raum klar abgegrenzt, wie<br />
z. B. Mietergärten <strong>und</strong> Höfe oder auch Freiräume, die sozialen Einrichtungen zugeordnet<br />
sind (RÖßLER 2003, 34; SELLE, SUTTER-SCHURR 1993, 35f.). Diese Freiräume<br />
sind Bestandteile der Gr<strong>und</strong>stücke des Wohnungsbaus <strong>und</strong> der sozialen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> damit Bestandteil des Nettowohnbaulands.<br />
Auf der Ebene des Nettowohnbaulands bestimmt die Gr<strong>und</strong>flächenzahl (GRZ) das<br />
Verhältnis zwischen überbauter <strong>und</strong> nicht überbauter Gr<strong>und</strong>stücksfläche. Die nicht<br />
bebaute Gr<strong>und</strong>stücksfläche steht – abzüglich der gr<strong>und</strong>stückseigenen Zuwege <strong>und</strong><br />
Einstellplätze – <strong>für</strong> private oder im Mietwohnungsbau auch <strong>für</strong> halböffentliche Freiräume<br />
zur Verfügung.<br />
Die Nachfrage nach diesen privaten oder halböffentlichen Freiräumen in unmittelbarer<br />
Wohnungsnähe wird bestimmt durch die Nettowohndichte. Bei gleichbleibender<br />
Bebauungsdichte <strong>und</strong> Geschosshöhe nimmt dabei die verfügbare Freifläche je Einwohner<br />
zu, wenn die Anteile der Wohnfläche <strong>und</strong> damit der Bruttogeschossfläche je<br />
Einwohner ebenfalls zunehmen. So stellte ALBERS bereits 1964 eine Diskrepanz in<br />
der Erfüllung der Bedürfnisse fest:<br />
„(...) wer in seiner Wohnung großzügige räumliche Verhältnisse besitzt, verfügt<br />
zugleich über einen entsprechend höheren Freiflächenanteil als der beengter<br />
Wohnende, obwohl dieser gerade wegen seines knappen Wohnflächenanteils<br />
der Freifläche um das Gebäude dringender bedarf.“ (ALBERS 1964, 46)<br />
Für die erforderlichen Mindestmaße privater Freifläche je Einwohner existieren verschiedene<br />
Orientierungswerte. ALBERS (1964, 48) sieht eine Freifläche von 10 bis<br />
12 m 2 als angemessen an, um ges<strong>und</strong>e Wohnverhältnisse zu ermöglichen. WEHR-