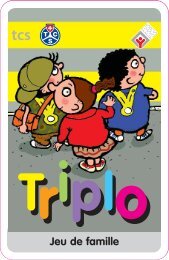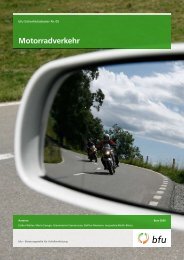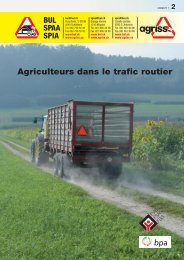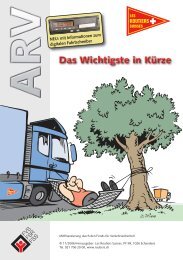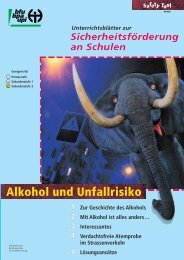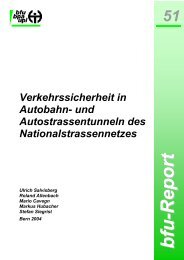Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
� Aufbau des Fahrrads<br />
� kleine räumliche Dimension<br />
� hohe Fahrinstabilität<br />
3.2.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz<br />
Aufbau des Fahrrads<br />
Zum einen ist das Fehlen einer Knautschzone zu<br />
erwähnen. Dies hat zur Konsequenz, dass die Verletzungsschwere<br />
insbesondere auf zwei andere<br />
Faktoren verlagert wird: einerseits auf die Kleidung<br />
resp. die persönliche Schutzausrüstung der Radfahrenden<br />
und andererseits auf die Eigenschaften des<br />
Kollisionsobjekts (vor allem auf die Konstruktionsmerkmale<br />
der Fahrzeugfront). Zum anderen sind<br />
hervorstehende Bauteile des Fahrrads selbst hervorzuheben,<br />
namentlich Lenkerenden und Pedale. Je<br />
nach Sturzmechanismus können dadurch schwere<br />
Verletzungen verursacht werden. Schwere Leberverletzungen<br />
bei Kindern (Quetschungen, Prellungen)<br />
sowie innere Verletzungen im Beckenbereich sind in<br />
diesem Zusammenhang besonders häufig.<br />
Räumliche Ausdehnung<br />
Die geringe räumliche Ausdehnung führt dazu,<br />
dass Radfahrende in bestimmten Verkehrskonstellationen<br />
von motorisierten Verkehrsteilnehmenden<br />
leicht übersehen werden. So verwundert es nicht,<br />
dass die häufigste Unfallursache bei Motorfahrzeug-Fahrrad-Kollisionen<br />
gemäss der Strassenverkehrsunfallstatistik<br />
die Vortrittsmissachtung ist. Bei<br />
37 % der schweren Kollisionen wird dieser Mangel<br />
dem Kollisionsgegner angelastet, bei 22 % dem<br />
Radfahrer (Tabelle 24, S. 83). Die Missachtung des<br />
Vortritts der Radfahrenden ist vermutlich in der<br />
Regel nicht auf ein absichtliches Fehlverhalten der<br />
MFZ-Lenkenden im Sinn eines Konkurrenzkampfs<br />
zurückzuführen, sondern auf die kleinen Dimensionen<br />
von Fahrrädern. Letzteres bewirkt einerseits,<br />
dass Fahrräder oftmals zu spät oder gar nicht erkannt<br />
werden. Andererseits wird das Einschätzen<br />
der Geschwindigkeiten erschwert. Entgegen der<br />
Alltagsmeinung besteht das Problem der leichten<br />
Übersehbarkeit insbesondere während den hellen<br />
Tageszeiten und – sofern das Fahrrad vorschriftsmässig<br />
mit Licht ausgerüstet ist – nicht bei Dunkelheit.<br />
Dies hängt damit zusammen, dass das Fahrradlicht<br />
in der Nacht einen starken Kontrastreiz zur<br />
dunklen Umgebung darstellt und infolge dieser<br />
visuellen Auffälligkeit mit grösserer Wahrscheinlichkeit<br />
bewusst wahrgenommen wird.<br />
Fahrinstabilität<br />
Die Kombination des relativ hohen Schwerpunktes,<br />
der Einspurigkeit und der geringen Fahrgeschwindigkeit<br />
führt zu einer instabilen Lage des Gefährtes.<br />
Dadurch setzt ein sicheres Fahren sensomotorische<br />
Fertigkeiten voraus, die insbesondere bei Kindern,<br />
aber teilweise auch bei Senioren nicht gegeben sind.<br />
3.2.3 Risikobeurteilung<br />
Durch die Instabilität in Verbindung mit der fehlenden<br />
Knautschzone von Fahrrädern können auch<br />
kleine Fahrfehler oder minimale Versäumnisse<br />
schwerwiegende Folgen haben. Im Mischverkehr<br />
mit den Motorfahrzeugen erhöht sich das Problem,<br />
zumal hier auch die leichte Übersehbarkeit hinzukommt<br />
[70]. Die Risikobeurteilung im Sinn der<br />
Gefahrenquantifizierung ist bei den beschriebenen<br />
drei Grundproblemen aufgrund ihres hohen Abstraktionsgrades<br />
nicht sinnvoll.<br />
bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08 Risikofaktoren 115