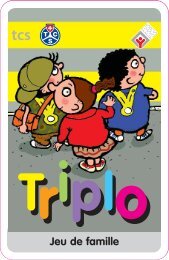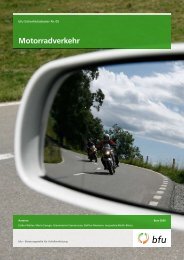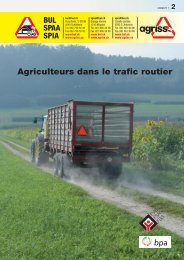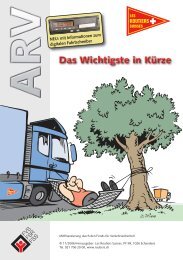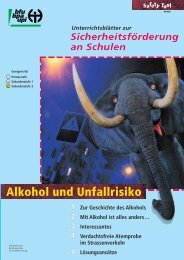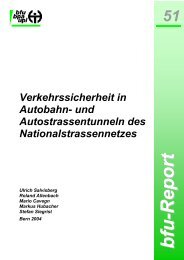Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kung des Helms weiter optimiert werden kann und<br />
welcher Handlungsbedarf aus der Sicht der<br />
Schweiz diesbezüglich besteht. In Kapitel VII.4.6,<br />
S. 207 wird thematisiert, wie die Tragquote in der<br />
Schweiz weiter erhöht werden kann. Hier interessieren<br />
vor allem die Ergebnisse aus der internationalen<br />
Literatur bzw. der Erfolge edukativer Bemühungen<br />
(Schulungsprogramme, Kommunikationskampagnen)<br />
sowie legislativer Strategien (Helmobligatorium).<br />
Auch Kapitel VII.4.6, S. 207 enthält<br />
Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> die Schweiz. In<br />
Kapitel VII.4.7, S. 214 erfolgt schliesslich eine Zusammenfassung<br />
über alle Kapitel53 .<br />
Bei der internationalen Literatur wird wenn immer<br />
möglich auf Übersichtsarbeiten («systematic reviews»)<br />
verwiesen. Einzelstudien zeigen oftmals<br />
divergierende Ergebnisse und müssen aus diesem<br />
Grund ausführlich diskutiert werden. Abschliessende<br />
Schlussfolgerungen bleiben meist schwierig. Aus<br />
Ressourcengründen können diese detaillierten Diskussionen<br />
im vorliegenden Bericht nicht geführt<br />
werden und es bleiben wichtige Themen unerörtert.<br />
So fehlt eine Diskussion über mögliche unerwünschte<br />
Effekte infolge eines Helmobligatoriums (z. B.<br />
weniger Radfahrende, Risikokompensation). Auch<br />
zum Thema Kosten-Nutzen-Überlegungen liegen<br />
keine Übersichtsarbeiten vor.<br />
4.2 Kopfverletzungen<br />
4.2.1 Verletzungsmechanismen und -kriterien<br />
Der menschliche Kopf lässt sich durch einen mehrschichtigen<br />
Aufbau beschreiben: die äusseren<br />
Weichteile (z. B. Kopfschwarte), der knöcherne<br />
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯<br />
53 Wir danken Kai-Uwe Schmitt (Institut <strong>für</strong> Biomedizinische<br />
Technik, ETH Zürich und Arbeitsgruppe <strong>für</strong> Unfallmechanik,<br />
Zürich) <strong>für</strong> seine wertvolle Mitarbeit. Seine Expertise floss insbesondere<br />
in die Kapitel VII.4.2.1, VII.4.3.1 und VII.4.5 ein.<br />
Schädel und das von den Hirnhäuten umschlossene<br />
Gehirn. Letzteres ist zudem von einer Flüssigkeit<br />
(cerebrospinale Flüssigkeit, Liquor) umspült. Das<br />
Gehirn ist somit nicht fest mit den Schädelknochen<br />
verbunden. Durch mechanische Belastungen<br />
können die Kopfstrukturen verletzt werden<br />
(Abbildung 33) [152]. Weichteile können u. a. Prellungen,<br />
Quetschungen, Riss- oder Schnittwunden<br />
erleiden. Am Schädel können Knochenbrüche (Frakturen)<br />
auftreten und auch das Gehirn kann auf<br />
verschiedene Weise verletzt werden. Es können<br />
lokal begrenzte Hirnverletzungen auftreten, z. B.<br />
lokale Blutungen oder Prellungen (Kontusionen).<br />
Diese Verletzungen sind räumlich begrenzt. Es können<br />
jedoch auch diffuse Hirnverletzungen auftreten,<br />
die einen grösseren Bereich des Gehirns betreffen,<br />
z. B. Gehirnerschütterungen, Schwellungen<br />
oder diffuse Verletzungen der Nervenstrukturen.<br />
Welche Verletzungen auftreten, hängt mit der Art<br />
der Kopfbelastung und den dadurch wirksamen<br />
Verletzungsmechanismen zusammen. Ein direkter<br />
Anprall führt zu einer Kontaktkraft. Hierdurch<br />
können oberflächliche Weichteile verletzt werden<br />
oder Schädelfrakturen entstehen. Zudem kann<br />
durch eine solche stossartige Belastung des Kopfes<br />
auch das Gehirn verletzt werden, da sich dieses<br />
relativ zu den Schädelknochen bewegen kann.<br />
Erfolgt beispielsweise ein Stoss auf die Stirn, drückt<br />
der Schädel erst gegen das Hirngewebe im frontalen<br />
Bereich, sodass hier eine Kontusion entstehen<br />
kann. Anschliessend wird sich das Gehirn mit gewisser<br />
zeitlicher Verzögerung in Richtung Hinterkopf<br />
bewegen. Dabei kann der hintere Teil des<br />
Gehirns wiederum an den Schädel anstossen und<br />
sich dabei eine Prellung zuziehen. Somit ist es<br />
möglich, dass bei einem Kopfanprall zwei Kontusionsmarken<br />
am Gehirn entstehen (sogenannte<br />
Coup-Contrecoup-Verletzung). Durch die relative<br />
196 Prävention bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08