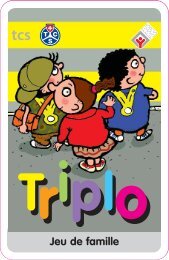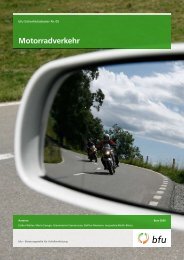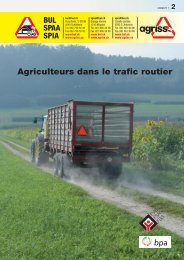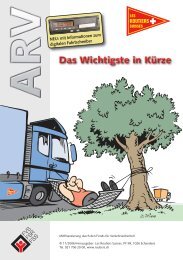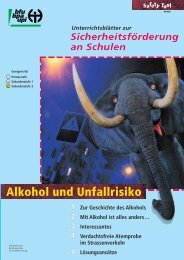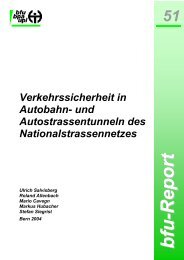Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unter dem Begriff Fahrkompetenz werden jene<br />
psychischen und physischen Voraussetzungen verstanden,<br />
die durch Lernprozesse beeinflusst werden<br />
können. Sie sind – einmal erworben – relativ<br />
stabil vorhanden. Thematisiert werden verkehrsrelevantes<br />
Wissen (Kap. VI.2.5, S. 94) sowie sicherheitsförderliche<br />
Einstellungen (Kap. VI.2.6, S. 96).<br />
Sind die Voraussetzungen der Fahreignung und Fahrkompetenz<br />
erfüllt, können trotzdem punktuelle Risiken<br />
vorhanden sein. Diese sind aber zeitlich begrenzt.<br />
Unter dem Begriff Fahrfähigkeit werden jene<br />
psychischen und physischen Voraussetzungen verstanden,<br />
die – bei gegebener Fahreignung und<br />
Fahrkompetenz – zum Zeitpunkt des Fahrens vorhanden<br />
sein müssen. Thematisiert werden die<br />
Fahrunfähigkeit durch Alkoholkonsum (Kap. VI.2.7,<br />
S. 98) und Ablenkung durch mediale Geräte<br />
(Kap. VI.2.8, S. 100). Der Müdigkeit als weiter die<br />
Fahrfähigkeit zeitweilig beeinflussenden Faktor<br />
kommt durch die körperliche Aktivität beim Radfahren<br />
nur wenig Bedeutung zu.<br />
Fahreignung, Fahrkompetenz und Fahrfähigkeit<br />
führen zu entsprechendem Fahrverhalten. Auf<br />
der Ebene des konkret beobachtbaren Fahrverhaltens<br />
werden die Motorik (Kap. VI.2.9, S. 101), der<br />
Fahrstil (Kap. VI.2.10, S. 105), die Fahrgeschwindigkeit<br />
(Kap. VI.2.11, S. 106), regelwidriges Verhalten<br />
(Kap. VI.2.12, S. 108) sowie das Schutzverhalten,<br />
namentlich zur Erhöhung der Erkennbarkeit<br />
(Kap. VI.2.13, S. 110), thematisiert.<br />
Im Anschluss daran werden nach soziodemographi-<br />
schen Merkmalen Risikogruppen definiert, bei denen<br />
die besprochenen Risikofaktoren konzentriert zu<br />
finden sind (Kap. VI.2.14, S. 111). Als Übersicht folgt<br />
am Ende des Kapitels ein Fazit (Kap. VI.2.15, S. 113).<br />
2.2 Fahreignung: Wahrnehmung und<br />
Informationsverarbeitung<br />
2.2.1 Ausgangslage und Verbreitung<br />
Im Strassenverkehr sind <strong>für</strong> Radfahrende hauptsächlich<br />
die visuelle und die auditive Wahrnehmung<br />
wichtig. Diese Wahrnehmungen ändern sich<br />
bei normaler Entwicklung während der Lebensspanne.<br />
Dasselbe gilt <strong>für</strong> die Informationsverarbeitung,<br />
die massgeblich durch die Konzentrationsund<br />
Aufmerksamkeitsfähigkeit beeinflusst wird.<br />
Kinder sind in ihrem peripheren Sehen eingeschränkt.<br />
Bei 6- bis 7-Jährigen ist dieses erst etwa zu<br />
70 % ausgebildet. Ein herannahendes Auto von<br />
links oder rechts befindet sich daher lange ausserhalb<br />
ihres Blickfeldes. Auch das dreidimensionale<br />
Tiefensehen braucht viel Übung und Erfahrung.<br />
Mangelndes Tiefensehen bewirkt, dass Entfernungen<br />
und Geschwindigkeiten nicht richtig eingeschätzt<br />
werden können. 3- bis 4-Jährige erkennen<br />
meist nicht, ob ein Fahrzeug steht oder fährt. Bei<br />
stark befahrenen Strassen wählen Kinder daher oft<br />
zu kurze Zeitintervalle zwischen herannahenden<br />
Autos [14]. Was Kindern als gute Lücke erscheint, ist<br />
in Wirklichkeit zu wenig Zeit, um die Strasse sicher<br />
zu überqueren. Erst mit 6 Jahren können Entfernungen<br />
und mit 10 Jahren Geschwindigkeiten annähernd<br />
richtig eingeschätzt werden [15,16]. Da sich<br />
Kinder unter 10 Jahren bei Strassenüberquerungen<br />
nach der Distanz und nicht nach der Geschwindigkeit<br />
der Fahrzeuge richten, wählen sie ungeachtet<br />
der Situation eine immer gleich grosse Lücke. Durch<br />
dieses Verhalten wird ihre Sicherheit durch Fahrzeuge,<br />
die zu schnell fahren, besonders gefährdet [17].<br />
Das Hörvermögen bezüglich laut/leise und<br />
hoch/tief ist bereits bei Kleinkindern gut und mit<br />
6 Jahren voll entwickelt. Hingegen hapert es in die-<br />
bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08 Risikofaktoren 87