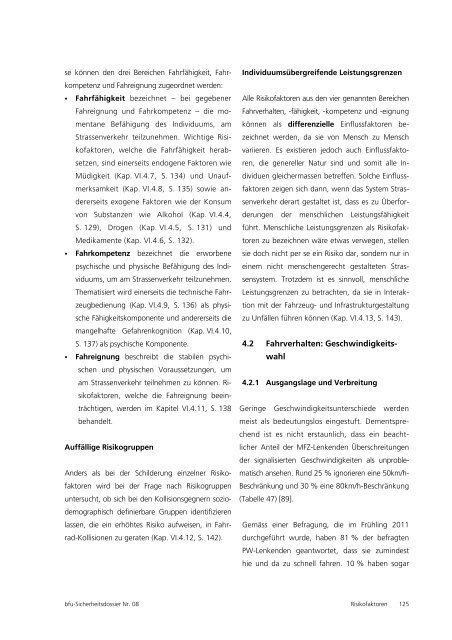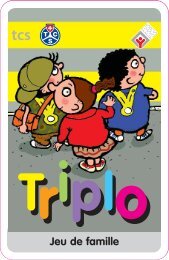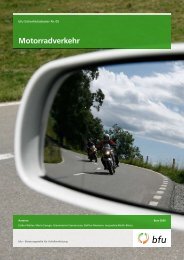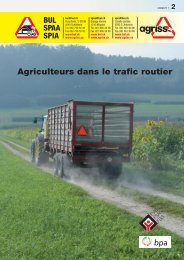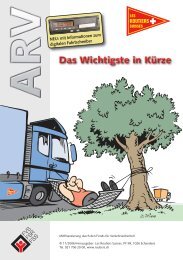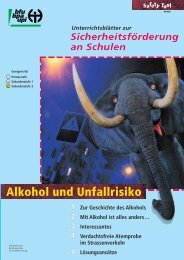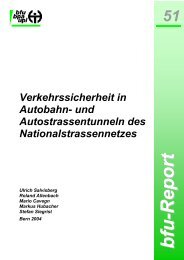Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
se können den drei Bereichen Fahrfähigkeit, Fahrkompetenz<br />
und Fahreignung zugeordnet werden:<br />
� Fahrfähigkeit bezeichnet – bei gegebener<br />
Fahreignung und Fahrkompetenz – die momentane<br />
Befähigung des Individuums, am<br />
Strassenverkehr teilzunehmen. Wichtige Risikofaktoren,<br />
welche die Fahrfähigkeit herabsetzen,<br />
sind einerseits endogene Faktoren wie<br />
Müdigkeit (Kap. VI.4.7, S. 134) und Unaufmerksamkeit<br />
(Kap. VI.4.8, S. 135) sowie andererseits<br />
exogene Faktoren wie der Konsum<br />
von Substanzen wie Alkohol (Kap. VI.4.4,<br />
S. 129), Drogen (Kap. VI.4.5, S. 131) und<br />
Medikamente (Kap. VI.4.6, S. 132).<br />
� Fahrkompetenz bezeichnet die erworbene<br />
psychische und physische Befähigung des Individuums,<br />
um am Strassenverkehr teilzunehmen.<br />
Thematisiert wird einerseits die technische Fahrzeugbedienung<br />
(Kap. VI.4.9, S. 136) als physische<br />
Fähigkeitskomponente und andererseits die<br />
mangelhafte Gefahrenkognition (Kap. VI.4.10,<br />
S. 137) als psychische Komponente.<br />
� Fahreignung beschreibt die stabilen psychischen<br />
und physischen Voraussetzungen, um<br />
am Strassenverkehr teilnehmen zu können. Risikofaktoren,<br />
welche die Fahreignung beeinträchtigen,<br />
werden im Kapitel VI.4.11, S. 138<br />
behandelt.<br />
Auffällige Risikogruppen<br />
Anders als bei der Schilderung einzelner Risikofaktoren<br />
wird bei der Frage nach Risikogruppen<br />
untersucht, ob sich bei den Kollisionsgegnern soziodemographisch<br />
definierbare Gruppen identifizieren<br />
lassen, die ein erhöhtes Risiko aufweisen, in Fahrrad-Kollisionen<br />
zu geraten (Kap. VI.4.12, S. 142).<br />
Individuumsübergreifende Leistungsgrenzen<br />
Alle Risikofaktoren aus den vier genannten Bereichen<br />
Fahrverhalten, -fähigkeit, -kompetenz und -eignung<br />
können als differenzielle Einflussfaktoren bezeichnet<br />
werden, da sie von Mensch zu Mensch<br />
variieren. Es existieren jedoch auch Einflussfaktoren,<br />
die genereller Natur sind und somit alle Individuen<br />
gleichermassen betreffen. Solche Einflussfaktoren<br />
zeigen sich dann, wenn das System Strassenverkehr<br />
derart gestaltet ist, dass es zu Überforderungen<br />
der menschlichen Leistungsfähigkeit<br />
führt. Menschliche Leistungsgrenzen als Risikofaktoren<br />
zu bezeichnen wäre etwas verwegen, stellen<br />
sie doch nicht per se ein Risiko dar, sondern nur in<br />
einem nicht menschengerecht gestalteten Strassensystem.<br />
Trotzdem ist es sinnvoll, menschliche<br />
Leistungsgrenzen zu betrachten, da sie in Interaktion<br />
mit der Fahrzeug- und Infrastrukturgestaltung<br />
zu Unfällen führen können (Kap. VI.4.13, S. 143).<br />
4.2 Fahrverhalten: Geschwindigkeitswahl<br />
4.2.1 Ausgangslage und Verbreitung<br />
Geringe Geschwindigkeitsunterschiede werden<br />
meist als bedeutungslos eingestuft. Dementsprechend<br />
ist es nicht erstaunlich, dass ein beachtlicher<br />
Anteil der MFZ-Lenkenden Überschreitungen<br />
der signalisierten Geschwindigkeiten als unproblematisch<br />
ansehen. Rund 25 % ignorieren eine 50km/h-<br />
Beschränkung und 30 % eine 80km/h-Beschränkung<br />
(Tabelle 47) [89].<br />
Gemäss einer Befragung, die im Frühling 2011<br />
durchgeführt wurde, haben 81 % der befragten<br />
PW-Lenkenden geantwortet, dass sie zumindest<br />
hie und da zu schnell fahren. 10 % haben sogar<br />
bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08 Risikofaktoren 125