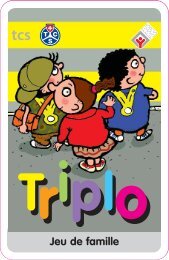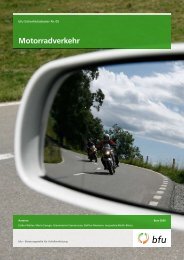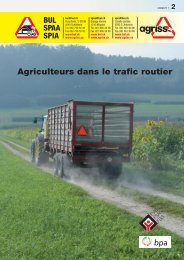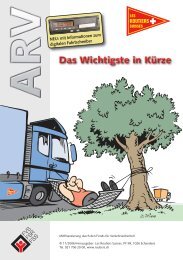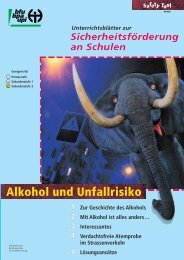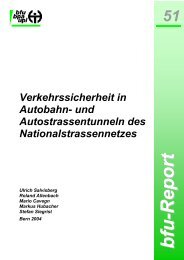Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Fahrradverkehr - Fonds für Verkehrssicherheit FVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prävention sollte grundsätzlich bei relevanten<br />
Risikofaktoren ansetzen, kann aber in begründe-<br />
ten Fällen von dieser Maxime abweichen. Es ist zu<br />
bedenken, dass die Unfallrelevanz zwar <strong>für</strong> das<br />
Kollektiv der Radfahrenden gering sein kann, <strong>für</strong><br />
spezifische Subgruppen aber beachtlich.<br />
Nach der Diskussion und Beurteilung der Unfallrelevanz<br />
von Risikofaktoren folgen im Kapitel Prävention<br />
die entsprechenden Zielsetzungen und Strategien<br />
zur Umsetzung. Dabei handelt es sich um sehr<br />
generelle Zielsetzungen (z. B. sicherheitsoptimierte<br />
Frontkonstruktionen bei Personenwagen, umfassende<br />
und flächendeckende Fahrradnetzplanung<br />
seitens der zuständigen Behörden). Strategien sagen<br />
noch nichts darüber aus, welche konkreten<br />
Massnahmen bzw. Aktivitäten ausgeführt werden<br />
sollten [4]. Im Auftrag des <strong>FVS</strong> werden einige ausgewählte<br />
Zielsetzungen präzisiert und zu konkreten<br />
Massnahmen verdichtet5 .<br />
Wenn möglich werden im Zusammenhang mit der<br />
Zielsetzung Angaben über das Präventionspotenzial<br />
gemacht (Welchen Nutzen bringt die Zielerfüllung?).<br />
Dabei handelt es sich oft um eine Abschätzung<br />
aus Expertensicht. Die Überlegungen stützen<br />
sich auf das Konzept des attributablen Risikos –<br />
einem in der Epidemiologie wichtigen Mass. Das<br />
attributable Risiko sagt aus, in welchem Ausmass<br />
ein Ereignis einem bestimmten Merkmal zugeschrieben<br />
werden kann [1]. Wie viele der nächtlichen<br />
Kollisionen zwischen Personenwagen und<br />
Radfahrenden lassen sich beispielsweise auf den<br />
Risikofaktor «Radfahren ohne Licht» zurückführen?<br />
Somit gibt das attributable Risiko (AR) Auskunft<br />
über das Präventionspotenzial (oft als Prozentangabe).<br />
Das AR entspricht nicht einfach dem Anteil<br />
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯<br />
5 Dieser zweite Teil des überarbeiteten Sicherheitsdossiers<br />
«<strong>Fahrradverkehr</strong>» wird separat erstellt.<br />
Ereignisse mit dem entsprechenden Merkmal, d. h.<br />
nicht einfach der Anzahl nächtlicher Kollisionen,<br />
bei denen der Radfahrer ohne Licht unterwegs<br />
war. Vielmehr haben auch Radfahrende, die mit<br />
Licht unterwegs sind ein gewisses Unfallrisiko.<br />
Dieses sogenannte Hintergrundrisiko muss bei der<br />
Ermittlung des Präventionspotenzials mitberücksichtigt<br />
werden6 .<br />
Bei der Umsetzung der Ziele können verschiedene<br />
Strategien zur Anwendung kommen. Unter Strategien<br />
werden Ansätze und Vorgehensweisen<br />
verstanden, die der Zielerreichung dienen [4]. Im<br />
übergeordneten Sinn handelt es sich z. B. um edukative<br />
Strategien (Informieren in den Schulen), um<br />
legislative Strategien (Kontrollieren durch Gesetze)<br />
oder um ökonomische Strategien (Anreize schaffen).<br />
Im Sicherheitsdossier werden <strong>für</strong> jedes Ziel<br />
verschiedene Strategien diskutiert (z. B. Gesetze<br />
erlassen, d. h. ein Obligatorium zur Erreichung<br />
einer höheren Fahrradhelmtragquote). Wenn möglich<br />
wird aufgrund der Literatur die Wirksamkeit<br />
der Strategien diskutiert. Zum Teil lassen sich die<br />
Strategien evidenzbasiert konkretisieren, zum Teil<br />
entstehen sie aufgrund von Expertenurteilen: Welche<br />
Zielgruppen sollen z. B. über welche Kanäle<br />
wie informiert werden.<br />
Als letzter Arbeitsschritt erfolgt eine Beurteilung<br />
dieser (mehr oder weniger konkreten) Präventionsvorschläge.<br />
Die Beurteilung erfolgt anhand einer Skala<br />
von «sehr empfehlenswert», «empfehlenswert»,<br />
«bedingt empfehlenswert» oder «nicht empfehlenswert»<br />
und wird tabellarisch dargestellt. Der Einfachheit<br />
halber wird nun als Tabellenüberschrift von<br />
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯<br />
6 So wird im Sicherheitsdossier z. B. angenommen, dass die<br />
Kollisionen an Knoten mit Lichtsignal-Regelung nur zur<br />
Hälfte durch korrekte infrastrukturelle Interventionen reduziert<br />
werden könnten (die andere Hälfte der Kollisionen<br />
würde sich wohl auch bei korrekter Ausführung ereignen).<br />
62 Einleitung bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08