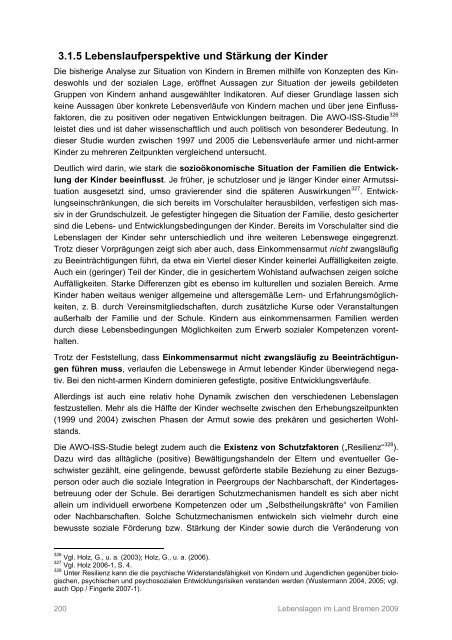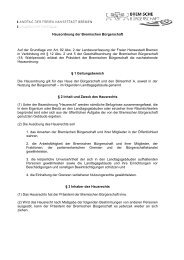- Seite 1 und 2:
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache
- Seite 3 und 4:
L e b e n s l a g e n im Land Breme
- Seite 5 und 6:
Inhalt 0. KURZFASSUNG 5 1. EINLEITU
- Seite 7 und 8:
0. Kurzfassung Auftrag und Aufbau d
- Seite 9 und 10:
Einkommen, Schulden und Transferlei
- Seite 11 und 12:
Chancen durch Bildung Kurzfassung B
- Seite 13 und 14:
Gesundheit Kurzfassung Gesundheit s
- Seite 15 und 16:
Kinder und ihre Lebensbedingungen i
- Seite 17 und 18:
Menschen mit Behinderungen Kurzfass
- Seite 19 und 20:
Armut und Migration Kurzfassung Im
- Seite 21 und 22:
Frauen Kurzfassung Frauen gehören
- Seite 23 und 24:
Armut und Reichtum in Stadtteilen,
- Seite 25 und 26:
Strategien und Maßnahmen zur Bekä
- Seite 27 und 28:
Kurzfassung Eine der maßgeblichen
- Seite 29 und 30:
Handlungsfeld Kinderbetreuung, Erzi
- Seite 31 und 32:
Kurzfassung Verzahnung bringt Vorte
- Seite 33 und 34:
den dargestellten Handlungsfeldern
- Seite 35 und 36:
fast 60 %. Zwischen diesen besonder
- Seite 37 und 38:
In den 90er Jahren herrschte weitge
- Seite 39 und 40:
2. Lebenssituation im Land Bremen n
- Seite 41 und 42:
Grafik 2.1.2: Wanderungssalden der
- Seite 43 und 44:
che mit Migrationshintergrund erzog
- Seite 45 und 46:
Grafik 2.1.7: Alleinerziehende im L
- Seite 47 und 48:
Grafik 2.1.9: Bevölkerungsprognose
- Seite 49 und 50:
2.1.4 Sozialpolitik und demografisc
- Seite 51 und 52:
Wie werden Armut und Reichtum defin
- Seite 53 und 54:
Aus unterschiedlichen Datenbasen re
- Seite 55 und 56:
gens, waren es in der vierten Grupp
- Seite 57 und 58:
„Wiedervereinigungsbooms“ Anfan
- Seite 59 und 60:
und Umfang der Schulden Auskunft ge
- Seite 61 und 62:
Tabelle 2.2.5: Schuldner- bzw. Schu
- Seite 63 und 64:
Grafik 2.2.2: Privatverschuldungsin
- Seite 65 und 66:
Tabelle 2.2.7: Personen in Transfer
- Seite 67 und 68:
setzes vorgenommene Einführung ein
- Seite 69 und 70:
25,4 % festgelegt. Die Bundesbeteil
- Seite 71 und 72:
auf 69.433 im Dezember 2007 und dam
- Seite 73 und 74:
Zur Verbesserung der Leistungsquali
- Seite 75 und 76:
(38,5 %), Gera (35,7 %) und Offenba
- Seite 77 und 78:
lich dar, wenngleich die Anteile et
- Seite 79 und 80:
Die Abdeckung von Mehrbedarfen und
- Seite 81 und 82:
auf einem relativ mittelmäßigen N
- Seite 83 und 84:
2.3.2.2.1 Geringfügig entlohnte Be
- Seite 85 und 86:
schließlich geringfügig entlohnte
- Seite 87 und 88:
Tabelle 2.3.4: Entwicklung der Arbe
- Seite 89 und 90:
Tabelle 2.3.5: Arbeitslosigkeit äl
- Seite 91 und 92:
2.3.3.5 Jugendliche und junge Erwac
- Seite 93 und 94:
dass sich die Arbeitslosigkeit nich
- Seite 95 und 96:
Die statistisch erfasste Langzeitar
- Seite 97 und 98:
Für einen attraktiven Arbeitsmarkt
- Seite 99 und 100:
Tabelle 2.3.9: Beschäftigungspolit
- Seite 101 und 102:
Unterfonds 2.6 Aufstieg finanziell
- Seite 103 und 104:
Es kann nicht darum gehen, dass die
- Seite 105 und 106:
Arbeitsförderung für Migranten un
- Seite 107 und 108:
2.4.1.1 Schulabschlüsse im Verglei
- Seite 109 und 110:
2.4.1.2 Detailbetrachtung der Absch
- Seite 111 und 112:
Grafik 2.4.2: Schulabbrecher 2006 n
- Seite 113 und 114:
2.4.1.2.4 Absolventen und Absolvent
- Seite 115 und 116:
lagen beinhalten. Zur Verbesserung
- Seite 117 und 118:
Grafik 2.4.7: Bremer Ortsteile nach
- Seite 119 und 120:
2.4.4. Zusammenfassung der Ergebnis
- Seite 121 und 122:
Der Bremer Orientierungsrahmen „S
- Seite 123 und 124:
der Erfolgsdaten, wie höhere Absol
- Seite 125 und 126:
Haushalte mit ein bzw. zwei Persone
- Seite 127 und 128:
Segmenten des Bremer Wohnungsmarkte
- Seite 129 und 130:
2.5.2.3 Auswirkungen der Reform der
- Seite 131 und 132:
Räumliche Lage des Sozialwohnungsb
- Seite 133 und 134:
2.5.3 Haushalte mit hohem Einkommen
- Seite 135 und 136:
2.5.5 Maßnahmen 2.5.5.1 Qualitativ
- Seite 137 und 138:
Pflegefall kann ggf. zumindest zeit
- Seite 139 und 140:
Die Stadt Bremerhaven setzt in dem
- Seite 141 und 142:
2.6. Gesundheit 2.6.1 Gesundheit un
- Seite 143 und 144:
Grafik 2.6.2: Lebenserwartung in de
- Seite 145 und 146:
Auch im Hinblick auf die Säuglings
- Seite 147 und 148:
2.6.1.3 Kindergesundheit Bremen Der
- Seite 149 und 150:
liche Kompetenz und erhalten dann w
- Seite 155 und 156: • Alte Menschen sind von den meis
- Seite 157 und 158: Bremen lebenden Migrantinnen und Mi
- Seite 159 und 160: • bei anhaltender Arbeitslosigkei
- Seite 161 und 162: Grafik 2.6.8: Prognose Pflegebedür
- Seite 163 und 164: manchmal auch die familiäre Lebens
- Seite 165 und 166: Deutlich höher liegt der Anteil de
- Seite 167 und 168: Der Weg zur Bürgerstadt ist also e
- Seite 169 und 170: dem jeweiligen Parlament sozusagen
- Seite 171 und 172: Bremen hat mit beispielhaften Betei
- Seite 173 und 174: Anlass zur Einberufung der Enquete-
- Seite 175 und 176: Grafik 2.7.2: Bürgerschaftliches E
- Seite 177 und 178: Grafik 2.7.3: Engagement in verschi
- Seite 179 und 180: • Im “BSS Bremer Senior Service
- Seite 181: Menschen wegen ihres Geschlechtes,
- Seite 184 und 185: insbesondere in besonders benachtei
- Seite 186 und 187: Inwieweit kulturelle Aktivitäten i
- Seite 188 und 189: Ebenfalls nur geringe Unterschiede
- Seite 190 und 191: eine erste internationale Vergleich
- Seite 192 und 193: Im Bundesländervergleich lag Breme
- Seite 194 und 195: dem besonderen Schutz der Familie (
- Seite 196 und 197: Diese Befunde verweisen nicht allei
- Seite 198 und 199: und Qualifikationen die Schulen bee
- Seite 200 und 201: Tabelle 3.1.6: Betreuungsplätze f
- Seite 207 und 208: 3.2 Junge Menschen 3.2.1 Lebenslage
- Seite 209 und 210: lung, die Einpassung in die gesells
- Seite 211 und 212: alle Schulentlassenen eine Berufsau
- Seite 213 und 214: schulischen Maßnahmen der Ausbildu
- Seite 216 und 217: Jugendförderung Mit dem zuletzt du
- Seite 218 und 219: strukturellen Belastungsfaktoren ge
- Seite 220 und 221: 3.3 Menschen mit Behinderungen Armu
- Seite 222 und 223: 27 % - 28 % zu erhöhen ist, will m
- Seite 224 und 225: pflegerischen und therapeutischen A
- Seite 226 und 227: Gehörlosigkeit hat im Lebensverlau
- Seite 228 und 229: 3.3.2.2.1 Geplante Maßnahmen im sc
- Seite 230 und 231: 3.3.3.2 Maßnahmen zur Bekämpfung
- Seite 232 und 233: für behinderte Menschen bliebe, im
- Seite 234 und 235: Wohnheim betreut wurden. Dies ist i
- Seite 236 und 237: 3.4. Ältere Menschen 3.4.1. Bevöl
- Seite 238 und 239: • Die politisch vorgegebene Rente
- Seite 240 und 241: In den Einrichtungen des Betreuten
- Seite 242 und 243: Bei Überschreitung der sogenannten
- Seite 244 und 245: (vgl. Teil 2.5 dieses Berichts). Da
- Seite 246 und 247: Oft werden derartige Angebote hinte
- Seite 250 und 251: 3.5 Armut und Migration 3.5.1 Bevö
- Seite 252 und 253:
sich für die Arbeitsmarktintegrati
- Seite 254 und 255:
nahmen ergriffen, die eine höhere
- Seite 256 und 257:
log den Beziehern von SGB II und SG
- Seite 258 und 259:
Wohneigentum leben. 434 Eine Konzen
- Seite 260 und 261:
3.6. Armut und Wohnungslosigkeit 3.
- Seite 262 und 263:
Im Gegenteil potenziert längerfris
- Seite 264 und 265:
3.6.6 Übersicht Bremer Hilfesystem
- Seite 266 und 267:
geltvereinbarung und einer Garantie
- Seite 268 und 269:
Obdachlose in Notunterkünften Graf
- Seite 270 und 271:
Weitere Armutsrisiken und Ressource
- Seite 272:
Rd. die Hälfte (54 %) der Fälle i
- Seite 277:
Einfachhotels, die zur Unterbringun
- Seite 281 und 282:
3.7.1 Die Bevölkerung, der demogra
- Seite 283 und 284:
3.7.1.3 Die Zahl der potenziellen M
- Seite 285 und 286:
3.7.2.2 Vermögen Schon die ungleic
- Seite 287 und 288:
Eine Sonderform der Teilzeitarbeit
- Seite 289 und 290:
3.7.3.5 Frauen im Rechtskreis des S
- Seite 291 und 292:
Tabelle 3.7.4: Leistungsbezieherinn
- Seite 293 und 294:
3.7.3.8 Wirtschaftsstrukturentwickl
- Seite 295 und 296:
niedriger als noch 2001. Je mehr Ki
- Seite 297 und 298:
Diese Erfolgsmeldung verdeckt den B
- Seite 299 und 300:
Zwar ist der Frauenanteil an den vo
- Seite 301 und 302:
Im dualen System sind Frauen dagege
- Seite 303 und 304:
3.7.5.1 Wie können sozial benachte
- Seite 305:
3.7.5.3 Frauen, die Leistungen nach
- Seite 312 und 313:
mutslebenslage, die jedoch zumeist
- Seite 314 und 315:
Grafik 3.8.1: Berufliche Bildung vo
- Seite 316 und 317:
3.8.2.1 Arbeitslose Alleinerziehend
- Seite 318 und 319:
tener Beratungsgespräche und schli
- Seite 320 und 321:
Interventionsfelder, in denen die K
- Seite 322 und 323:
Abhängigkeit von Transfersystemen
- Seite 324 und 325:
tersgruppe, weil keine ausreichende
- Seite 326 und 327:
schlechtert. Sie gehören deutlich
- Seite 328 und 329:
Auch zeitliche oder situative Betre
- Seite 330 und 331:
3.8.6 Wohnen, Wohnumfeld und Quarti
- Seite 332 und 333:
Ebenso wichtig ist die infrastruktu
- Seite 334 und 335:
3.8.8.1 Ein Exkurs zur Zeit - Armut
- Seite 336:
situativ und bedarfsgerecht miteina
- Seite 343 und 344:
lität und selten miteinander vergl
- Seite 345 und 346:
4.2 Die Sozialindikatoren für die
- Seite 347 und 348:
4.3 Das Stadtmonitoring als kleinr
- Seite 349 und 350:
Grafik 4.3.1: Vermutungsgebiete soz
- Seite 351 und 352:
4.4 Lebenslagen auf Ebene der Ortst
- Seite 353 und 354:
In den Ortsteilen der unteren Einko
- Seite 355 und 356:
Grafik 4.4.2: Relation der Arbeitsl
- Seite 357 und 358:
Ortsteilen Tenever, Gröpelingen, N
- Seite 359 und 360:
Grafik 4.4.4: Räumliche Verteilung
- Seite 361 und 362:
Grafik 4.4.5: Relation des Anteils
- Seite 363 und 364:
Grafik 4.4.6: Relation des Anteils
- Seite 365 und 366:
in der Lebensphase junger Erwachsen
- Seite 367 und 368:
Grafik 4.4.8: Relation der Haushalt
- Seite 369 und 370:
Grafik 4.4.9: Relation des Anteils
- Seite 371 und 372:
4.4.5 Kumulative Effekte von Armut
- Seite 373 und 374:
zw. 30 %. Der Anteil von Bewohnern,
- Seite 375 und 376:
Die sozial besonders belasteten Bre
- Seite 377:
fortschreiende Segregation. Weitere
- Seite 382 und 383:
5.1. Die Lage im Land Bremen zeigt
- Seite 384 und 385:
vertritt und kollektive soziale Sic
- Seite 386 und 387:
Ohne Berufsausbildung steigen die R
- Seite 388 und 389:
5.4. Bündelung der Maßnahmen im S
- Seite 390 und 391:
Tabelle A.1: Übersicht der im ARB
- Seite 392 und 393:
390 Maßnahmen / Vorschläge Mehr P
- Seite 394 und 395:
392 Maßnahmen / Vorschläge Integr
- Seite 396 und 397:
394 Maßnahmen / Vorschläge Überg
- Seite 398 und 399:
396 Maßnahmen / Vorschläge Ehrena
- Seite 400 und 401:
398 Maßnahmen / Vorschläge Förde
- Seite 402 und 403:
Abkürzung Bedeutung STÄWOG Städt
- Seite 404 und 405:
Autorengruppe Bildungsberichterstat
- Seite 406 und 407:
BMAS (Bundesministerium für Arbeit
- Seite 408 und 409:
Bürgerstiftung Bremen / Arbeitnehm
- Seite 410 und 411:
GAB (Gesundheitsamt Bremen): Älter
- Seite 412 und 413:
Keupp, H.: Eine Gesellschaft der Ic
- Seite 414 und 415:
Revel, S.W.: Erwerbsintegration zug
- Seite 416 und 417:
Schröder, P.: Daten zur Kinderarmu
- Seite 418 und 419:
Statistisches Bundesamt: Wo bleibt
- Seite 420 und 421:
Abbildungsverzeichnis Grafik 2.1.1:
- Seite 422 und 423:
Tabelle 3.2.1: Jugendeinwohner im L