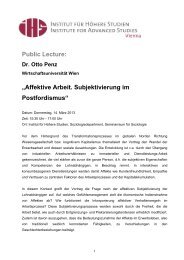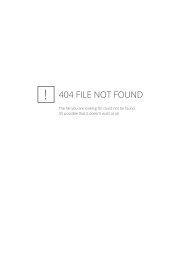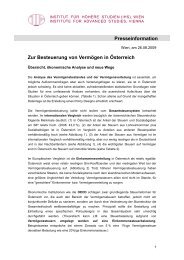Matrilineare Gesellschaften - Institute for Advanced Studies
Matrilineare Gesellschaften - Institute for Advanced Studies
Matrilineare Gesellschaften - Institute for Advanced Studies
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Regionalgebiet Afrika: Der ” matrilineare Gürtel“ 222<br />
4.4.4 Zigua und Ngulu in Ost-Tanzania<br />
Die Zigua und Ngulu in Ost-Tanzania sind Teil der nordöstlichen Fortsetzung des<br />
matrilinearen Gürtels der Kongo-Zambesi-Region. Die ursprünglich sehr ausgeprägten<br />
matrilinearen Merkmale erfuhren bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
eine Abschwächung, die sich mit der fast vollständigen Islamisierung zwischen<br />
1916 und 1926 weiter <strong>for</strong>tsetzte. Dadurch wurde unter anderem die traditionelle<br />
Erziehung der Knaben im Pubertätsalter durch die jando-Riten (Rundbeschneidung)<br />
ersetzt. Den Frauen werden aber innerhalb des Islams Rechte zugestanden,<br />
die sie an der Küste nicht hätten: z.B. ist ihnen der Besuch der Moscheen erlaubt<br />
sowie die Zubereitung der gemeinsamen Mahlzeit bei hohen islamischen Festtagen.<br />
119<br />
Das Siedlungsgebiet der Zigua und Ngulu bildet ein welliges Flachland, das mit<br />
Hügeln durchzogen ist; wobei die Ngulu-Berge eine Höhe von 1500 m erreichen<br />
und das östliche Flachland etwa 200 m über dem Meeresspiegel liegt. Die<br />
Landwirtschaft ist durch teilweise geringe Niederschläge und unzureichende Wasserläufe<br />
eingeschränkt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Viehzucht in<br />
den Tsetse-freien Gebieten intensiviert. Nach Elisabeth Grohs war die Stellung<br />
der Frau in der Vorkolonialzeit den Männern ebenbürtig. Als Bäuerinnen und<br />
Besitzerinnen des Viehs verfügten sie über das Land und vererbten es an ihre<br />
Kinder, oder häufiger über den mütterlichen Onkel. 120<br />
In der deutschen Kolonialzeit war das Erbrecht bereits auf den Vater übergegangen<br />
und zur Regel geworden. Obwohl der Handel von den Männern monopolisiert<br />
war und ist, profitierten die Frauen früher davon: sie erhielten aus den<br />
Einkünften Geschenke wie Schmuck, Körperöle und Baumwollstoffe für die Frauenkleidung,<br />
die sie bei Hungersnöten wieder in Nahrungsmittel tauschen konnten.<br />
Heute sind diese Geschenke nicht mehr vorhanden oder nicht bezahlbar und<br />
die Frauen müssen vermehrt auf ihre persönlichen Ersparnisse an Ziegenherden<br />
zurückgreifen, um die Grundnahrung bezahlen zu können. Die traditionelle Arbeitsteilung<br />
veränderte sich durch die relativ häufige Abwesenheit der Männer,<br />
die unter anderem durch die Vermarktung der Ernte bedingt ist. Früher war es<br />
in den traditionellen Dörfern üblich, daß sich bestimmte Einheiten des Dorfes<br />
zusammenschlossen, die Frauen gemeinsam die Nahrung zubereiteten und verteilten<br />
sowie die Feldarbeit gemeinsam verrichteten. Mit dem Verschwinden der<br />
Einrichtung des kiwiri (Nachbarschaftsorganisation für die Feldarbeiten) sind die<br />
einzelnen Familien auf sich gestellt. Ein Versuch der Wiedereinführung der kommunalen<br />
Strukturen scheiterte am Mißtrauen, der willkürlich zusammengefaßten<br />
Dorfbewohner. 121<br />
119 Elisabeth Grohs (1995): Frauen und rituelle Macht am Beispiel der Zigua und Ngulu Ost-<br />
Tansanias, in: Ilse Lenz und Ute Luig (Hg.), Frauenmacht ohne Herrschaft. – Geschlechterverhältnisse<br />
in nichtpatriarchalischen <strong>Gesellschaften</strong>, S.247–275; hier S.251.<br />
120 Grohs 1995, Frauen und rituelle Macht am Beispiel der Zigua und Ngulu, S.247–248.<br />
121 Grohs 1995, Frauen und rituelle Macht am Beispiel der Zigua und Ngulu, S.248–249.