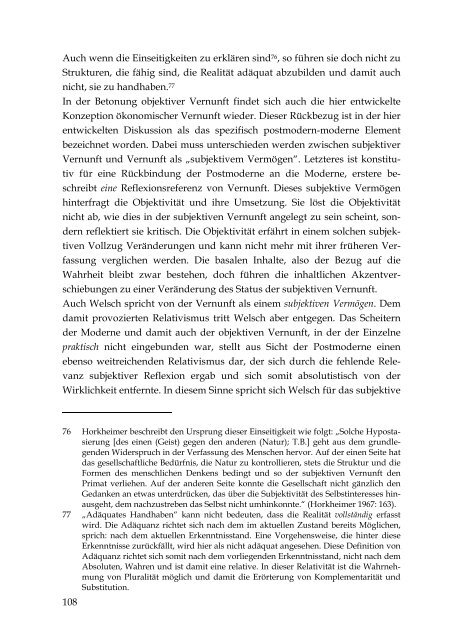TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auch wenn die Einseitigkeiten zu erklären sind76, so führen sie doch nicht zu<br />
<strong>St</strong>rukturen, die fähig sind, die Realität adäquat abzubilden und damit auch<br />
nicht, sie zu handhaben. 77<br />
In der Betonung objektiver Vernunft findet sich auch die hier entwickelte<br />
Konzeption ökonomischer Vernunft wieder. Dieser Rückbezug ist in der hier<br />
entwickelten Diskussion als das spezifisch postmodern-moderne Element<br />
bezeichnet worden. Dabei muss unterschieden werden zwischen subjektiver<br />
Vernunft und Vernunft als „subjektivem Vermögen“. Letzteres ist konstitutiv<br />
für eine Rückbindung der Postmoderne an die Moderne, erstere beschreibt<br />
eine Reflexionsreferenz von Vernunft. Dieses subjektive Vermögen<br />
hinterfragt die Objektivität und ihre Umsetzung. Sie löst die Objektivität<br />
nicht ab, wie dies in der subjektiven Vernunft angelegt zu sein scheint, sondern<br />
reflektiert sie kritisch. Die Objektivität erfährt in einem solchen subjektiven<br />
Vollzug Veränderungen und kann nicht mehr mit ihrer früheren Verfassung<br />
verglichen werden. Die basalen Inhalte, also der Bezug auf die<br />
Wahrheit bleibt zwar bestehen, doch führen die inhaltlichen Akzentverschiebungen<br />
zu einer Veränderung des <strong>St</strong>atus der subjektiven Vernunft.<br />
Auch Welsch spricht von der Vernunft als einem subjektiven Vermögen. Dem<br />
damit provozierten Relativismus tritt Welsch aber entgegen. Das Scheitern<br />
der Moderne und damit auch der objektiven Vernunft, in der der Einzelne<br />
praktisch nicht eingebunden war, stellt aus Sicht der Postmoderne einen<br />
ebenso weitreichenden Relativismus dar, der sich durch die fehlende Relevanz<br />
subjektiver Reflexion ergab und sich somit absolutistisch von der<br />
Wirklichkeit entfernte. In diesem Sinne spricht sich Welsch für das subjektive<br />
76 Horkheimer beschreibt den Ursprung dieser Einseitigkeit wie folgt: „Solche Hypostasierung<br />
[des einen (Geist) gegen den anderen (Natur); T.B.] geht aus dem grundlegenden<br />
Widerspruch in der Verfassung des Menschen hervor. Auf der einen Seite hat<br />
das gesellschaftliche Bedürfnis, die Natur zu kontrollieren, stets die <strong>St</strong>ruktur und die<br />
Formen des menschlichen Denkens bedingt und so der subjektiven Vernunft den<br />
Primat verliehen. Auf der anderen Seite konnte die Gesellschaft nicht gänzlich den<br />
Gedanken an etwas unterdrücken, das über die Subjektivität des Selbstinteresses hinausgeht,<br />
dem nachzustreben das Selbst nicht umhinkonnte.“ (Horkheimer 1967: 163).<br />
77 „Adäquates Handhaben“ kann nicht bedeuten, dass die Realität vollständig erfasst<br />
wird. Die Adäquanz richtet sich nach dem im aktuellen Zustand bereits Möglichen,<br />
sprich: nach dem aktuellen Erkenntnisstand. Eine Vorgehensweise, die hinter diese<br />
Erkenntnisse zurückfällt, wird hier als nicht adäquat angesehen. Diese Definition von<br />
Adäquanz richtet sich somit nach dem vorliegenden Erkenntnisstand, nicht nach dem<br />
Absoluten, Wahren und ist damit eine relative. In dieser Relativität ist die Wahrnehmung<br />
von Pluralität möglich und damit die Erörterung von Komplementarität und<br />
Substitution.<br />
108