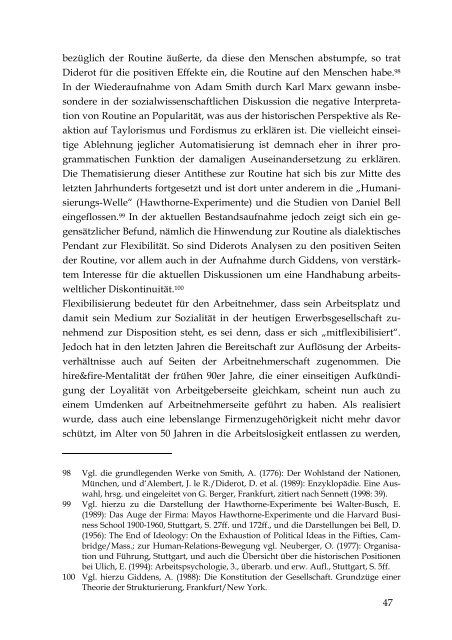TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ezüglich der Routine äußerte, da diese den Menschen abstumpfe, so trat<br />
Diderot für die positiven Effekte ein, die Routine auf den Menschen habe. 98<br />
In der Wiederaufnahme von Adam Smith durch Karl Marx gewann insbesondere<br />
in der sozialwissenschaftlichen Diskussion die negative Interpretation<br />
von Routine an Popularität, was aus der historischen Perspektive als Reaktion<br />
auf Taylorismus und Fordismus zu erklären ist. Die vielleicht einseitige<br />
Ablehnung jeglicher Automatisierung ist demnach eher in ihrer programmatischen<br />
Funktion der damaligen Auseinandersetzung zu erklären.<br />
Die Thematisierung dieser Antithese zur Routine hat sich bis zur Mitte des<br />
letzten Jahrhunderts fortgesetzt und ist dort unter anderem in die „Humanisierungs-Welle“<br />
(Hawthorne-Experimente) und die <strong>St</strong>udien von Daniel Bell<br />
eingeflossen. 99 In der aktuellen Bestandsaufnahme jedoch zeigt sich ein gegensätzlicher<br />
Befund, nämlich die Hinwendung zur Routine als dialektisches<br />
Pendant zur Flexibilität. So sind Diderots Analysen zu den positiven Seiten<br />
der Routine, vor allem auch in der Aufnahme durch Giddens, von verstärktem<br />
Interesse für die aktuellen Diskussionen um eine Handhabung arbeitsweltlicher<br />
Diskontinuität. 100<br />
Flexibilisierung bedeutet für den Arbeitnehmer, dass sein Arbeitsplatz und<br />
damit sein Medium zur Sozialität in der heutigen Erwerbsgesellschaft zunehmend<br />
zur Disposition steht, es sei denn, dass er sich „mitflexibilisiert“.<br />
Jedoch hat in den letzten Jahren die Bereitschaft zur Auflösung der Arbeitsverhältnisse<br />
auch auf Seiten der Arbeitnehmerschaft zugenommen. Die<br />
hire&fire-Mentalität der frühen 90er Jahre, die einer einseitigen Aufkündigung<br />
der Loyalität von Arbeitgeberseite gleichkam, scheint nun auch zu<br />
einem Umdenken auf Arbeitnehmerseite geführt zu haben. Als realisiert<br />
wurde, dass auch eine lebenslange Firmenzugehörigkeit nicht mehr davor<br />
schützt, im Alter von 50 Jahren in die Arbeitslosigkeit entlassen zu werden,<br />
98 Vgl. die grundlegenden Werke von Smith, A. (1776): Der Wohlstand der Nationen,<br />
München, und d‘Alembert, J. le R./Diderot, D. et al. (1989): Enzyklopädie. Eine Auswahl,<br />
hrsg. und eingeleitet von G. Berger, Frankfurt, zitiert nach Sennett (1998: 39).<br />
99 Vgl. hierzu zu die Darstellung der Hawthorne-Experimente bei Walter-Busch, E.<br />
(1989): Das Auge der Firma: Mayos Hawthorne-Experimente und die Harvard Business<br />
School 1900-1960, <strong>St</strong>uttgart, S. 27ff. und 172ff., und die Darstellungen bei Bell, D.<br />
(1956): The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Cambridge/Mass.;<br />
zur Human-Relations-Bewegung vgl. Neuberger, O. (1977): Organisation<br />
und Führung, <strong>St</strong>uttgart, und auch die Übersicht über die historischen Positionen<br />
bei Ulich, E. (1994): Arbeitspsychologie, 3., überarb. und erw. Aufl., <strong>St</strong>uttgart, S. 5ff.<br />
100 Vgl. hierzu Giddens, A. (1988): Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer<br />
Theorie der <strong>St</strong>rukturierung, Frankfurt/New York.<br />
47