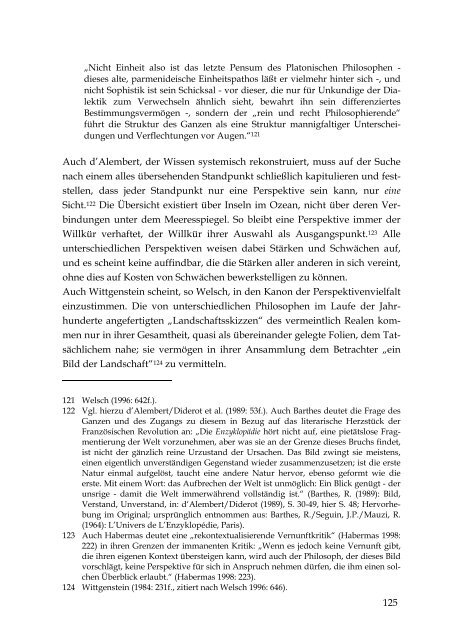TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Nicht Einheit also ist das letzte Pensum des Platonischen Philosophen -<br />
dieses alte, parmenideische Einheitspathos läßt er vielmehr hinter sich -, und<br />
nicht Sophistik ist sein Schicksal - vor dieser, die nur für Unkundige der Dialektik<br />
zum Verwechseln ähnlich sieht, bewahrt ihn sein differenziertes<br />
Bestimmungsvermögen -, sondern der „rein und recht Philosophierende“<br />
führt die <strong>St</strong>ruktur des Ganzen als eine <strong>St</strong>ruktur mannigfaltiger Unterscheidungen<br />
und Verflechtungen vor Augen.“ 121<br />
Auch d’Alembert, der Wissen systemisch rekonstruiert, muss auf der Suche<br />
nach einem alles übersehenden <strong>St</strong>andpunkt schließlich kapitulieren und feststellen,<br />
dass jeder <strong>St</strong>andpunkt nur eine Perspektive sein kann, nur eine<br />
Sicht. 122 Die Übersicht existiert über Inseln im Ozean, nicht über deren Verbindungen<br />
unter dem Meeresspiegel. So bleibt eine Perspektive immer der<br />
Willkür verhaftet, der Willkür ihrer Auswahl als Ausgangspunkt. 123 Alle<br />
unterschiedlichen Perspektiven weisen dabei <strong>St</strong>ärken und Schwächen auf,<br />
und es scheint keine auffindbar, die die <strong>St</strong>ärken aller anderen in sich vereint,<br />
ohne dies auf Kosten von Schwächen bewerkstelligen zu können.<br />
Auch Wittgenstein scheint, so Welsch, in den Kanon der Perspektivenvielfalt<br />
einzustimmen. Die von unterschiedlichen Philosophen im Laufe der Jahrhunderte<br />
angefertigten „Landschaftsskizzen“ des vermeintlich Realen kommen<br />
nur in ihrer Gesamtheit, quasi als übereinander gelegte Folien, dem Tatsächlichem<br />
nahe; sie vermögen in ihrer Ansammlung dem Betrachter „ein<br />
Bild der Landschaft“ 124 zu vermitteln.<br />
121 Welsch (1996: 642f.).<br />
122 Vgl. hierzu d’Alembert/Diderot et al. (1989: 53f.). Auch Barthes deutet die Frage des<br />
Ganzen und des Zugangs zu diesem in Bezug auf das literarische Herzstück der<br />
Französischen Revolution an: „Die Enzyklopädie hört nicht auf, eine pietätslose Fragmentierung<br />
der Welt vorzunehmen, aber was sie an der Grenze dieses Bruchs findet,<br />
ist nicht der gänzlich reine Urzustand der Ursachen. Das Bild zwingt sie meistens,<br />
einen eigentlich unverständigen Gegenstand wieder zusammenzusetzen; ist die erste<br />
Natur einmal aufgelöst, taucht eine andere Natur hervor, ebenso geformt wie die<br />
erste. Mit einem Wort: das Aufbrechen der Welt ist unmöglich: Ein Blick genügt - der<br />
unsrige - damit die Welt immerwährend vollständig ist.“ (Barthes, R. (1989): Bild,<br />
Verstand, Unverstand, in: d‘Alembert/Diderot (1989), S. 30-49, hier S. 48; Hervorhebung<br />
im Original; ursprünglich entnommen aus: Barthes, R./Seguin, J.P./Mauzi, R.<br />
(1964): L’Univers de L’Enzyklopédie, Paris).<br />
123 Auch Habermas deutet eine „rekontextualisierende Vernunftkritik“ (Habermas 1998:<br />
222) in ihren Grenzen der immanenten Kritik: „Wenn es jedoch keine Vernunft gibt,<br />
die ihren eigenen Kontext übersteigen kann, wird auch der Philosoph, der dieses Bild<br />
vorschlägt, keine Perspektive für sich in Anspruch nehmen dürfen, die ihm einen solchen<br />
Überblick erlaubt.“ (Habermas 1998: 223).<br />
124 Wittgenstein (1984: 231f., zitiert nach Welsch 1996: 646).<br />
125