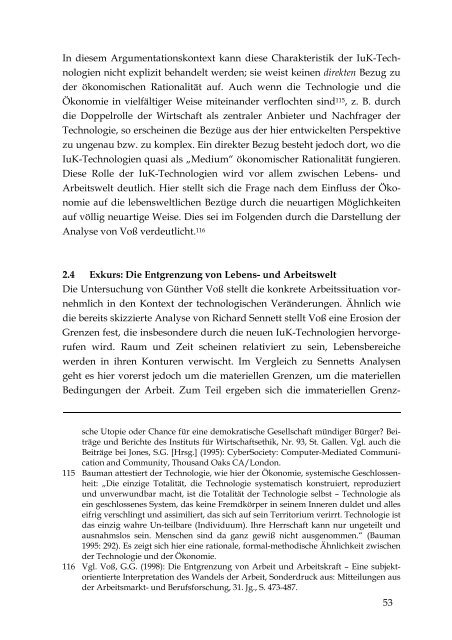TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In diesem Argumentationskontext kann diese Charakteristik der IuK-Technologien<br />
nicht explizit behandelt werden; sie weist keinen direkten Bezug zu<br />
der ökonomischen Rationalität auf. Auch wenn die Technologie und die<br />
Ökonomie in vielfältiger Weise miteinander verflochten sind115, z. B. durch<br />
die Doppelrolle der Wirtschaft als zentraler Anbieter und Nachfrager der<br />
Technologie, so erscheinen die Bezüge aus der hier entwickelten Perspektive<br />
zu ungenau bzw. zu komplex. Ein direkter Bezug besteht jedoch dort, wo die<br />
IuK-Technologien quasi als „Medium“ ökonomischer Rationalität fungieren.<br />
Diese Rolle der IuK-Technologien wird vor allem zwischen Lebens- und<br />
Arbeitswelt deutlich. Hier stellt sich die Frage nach dem Einfluss der Ökonomie<br />
auf die lebensweltlichen Bezüge durch die neuartigen Möglichkeiten<br />
auf völlig neuartige Weise. Dies sei im Folgenden durch die Darstellung der<br />
Analyse von Voß verdeutlicht. 116<br />
2.4 Exkurs: Die Entgrenzung von Lebens- und Arbeitswelt<br />
Die Untersuchung von Günther Voß stellt die konkrete Arbeitssituation vornehmlich<br />
in den Kontext der technologischen Veränderungen. Ähnlich wie<br />
die bereits skizzierte Analyse von Richard Sennett stellt Voß eine Erosion der<br />
Grenzen fest, die insbesondere durch die neuen IuK-Technologien hervorgerufen<br />
wird. Raum und Zeit scheinen relativiert zu sein, Lebensbereiche<br />
werden in ihren Konturen verwischt. Im Vergleich zu Sennetts Analysen<br />
geht es hier vorerst jedoch um die materiellen Grenzen, um die materiellen<br />
Bedingungen der Arbeit. Zum Teil ergeben sich die immateriellen Grenz-<br />
sche Utopie oder Chance für eine demokratische Gesellschaft mündiger Bürger? Beiträge<br />
und Berichte des Instituts für Wirtschaftsethik, Nr. 93, <strong>St</strong>. <strong>Gallen</strong>. Vgl. auch die<br />
Beiträge bei Jones, S.G. [Hrsg.] (1995): CyberSociety: Computer-Mediated Communication<br />
and Community, Thousand Oaks CA/London.<br />
115 Bauman attestiert der Technologie, wie hier der Ökonomie, systemische Geschlossenheit:<br />
„Die einzige Totalität, die Technologie systematisch konstruiert, reproduziert<br />
und unverwundbar macht, ist die Totalität der Technologie selbst – Technologie als<br />
ein geschlossenes System, das keine Fremdkörper in seinem Inneren duldet und alles<br />
eifrig verschlingt und assimiliert, das sich auf sein Territorium verirrt. Technologie ist<br />
das einzig wahre Un-teilbare (Individuum). Ihre Herrschaft kann nur ungeteilt und<br />
ausnahmslos sein. Menschen sind da ganz gewiß nicht ausgenommen.“ (Bauman<br />
1995: 292). Es zeigt sich hier eine rationale, formal-methodische Ähnlichkeit zwischen<br />
der Technologie und der Ökonomie.<br />
116 Vgl. Voß, G.G. (1998): Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft – Eine subjektorientierte<br />
Interpretation des Wandels der Arbeit, Sonderdruck aus: Mitteilungen aus<br />
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 31. Jg., S. 473-487.<br />
53