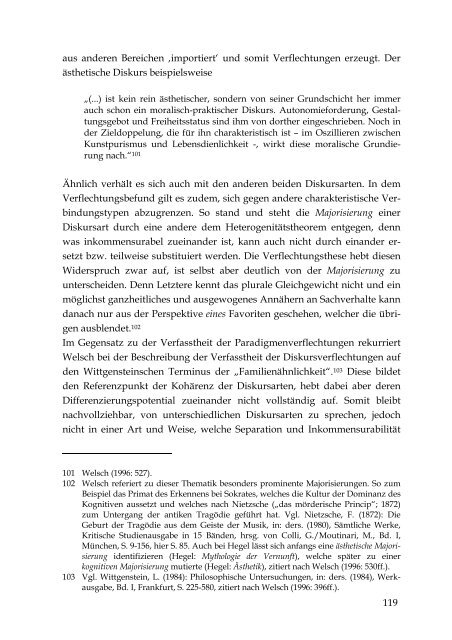TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
aus anderen Bereichen ‚importiert‘ und somit Verflechtungen erzeugt. Der<br />
ästhetische Diskurs beispielsweise<br />
„(...) ist kein rein ästhetischer, sondern von seiner Grundschicht her immer<br />
auch schon ein moralisch-praktischer Diskurs. Autonomieforderung, Gestaltungsgebot<br />
und Freiheitsstatus sind ihm von dorther eingeschrieben. Noch in<br />
der Zieldoppelung, die für ihn charakteristisch ist – im Oszillieren zwischen<br />
Kunstpurismus und Lebensdienlichkeit -, wirkt diese moralische Grundierung<br />
nach.“ 101<br />
Ähnlich verhält es sich auch mit den anderen beiden Diskursarten. In dem<br />
Verflechtungsbefund gilt es zudem, sich gegen andere charakteristische Verbindungstypen<br />
abzugrenzen. So stand und steht die Majorisierung einer<br />
Diskursart durch eine andere dem Heterogenitätstheorem entgegen, denn<br />
was inkommensurabel zueinander ist, kann auch nicht durch einander ersetzt<br />
bzw. teilweise substituiert werden. Die Verflechtungsthese hebt diesen<br />
Widerspruch zwar auf, ist selbst aber deutlich von der Majorisierung zu<br />
unterscheiden. Denn Letztere kennt das plurale Gleichgewicht nicht und ein<br />
möglichst ganzheitliches und ausgewogenes Annähern an Sachverhalte kann<br />
danach nur aus der Perspektive eines Favoriten geschehen, welcher die übrigen<br />
ausblendet. 102<br />
Im Gegensatz zu der Verfasstheit der Paradigmenverflechtungen rekurriert<br />
Welsch bei der Beschreibung der Verfasstheit der Diskursverflechtungen auf<br />
den Wittgensteinschen Terminus der „Familienähnlichkeit“. 103 Diese bildet<br />
den Referenzpunkt der Kohärenz der Diskursarten, hebt dabei aber deren<br />
Differenzierungspotential zueinander nicht vollständig auf. Somit bleibt<br />
nachvollziehbar, von unterschiedlichen Diskursarten zu sprechen, jedoch<br />
nicht in einer Art und Weise, welche Separation und Inkommensurabilität<br />
101 Welsch (1996: 527).<br />
102 Welsch referiert zu dieser Thematik besonders prominente Majorisierungen. So zum<br />
Beispiel das Primat des Erkennens bei Sokrates, welches die Kultur der Dominanz des<br />
Kognitiven aussetzt und welches nach Nietzsche („das mörderische Princip“; 1872)<br />
zum Untergang der antiken Tragödie geführt hat. Vgl. Nietzsche, F. (1872): Die<br />
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, in: ders. (1980), Sämtliche Werke,<br />
Kritische <strong>St</strong>udienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Colli, G./Moutinari, M., Bd. I,<br />
München, S. 9-156, hier S. 85. Auch bei Hegel lässt sich anfangs eine ästhetische Majorisierung<br />
identifizieren (Hegel: Mythologie der Vernunft), welche später zu einer<br />
kognitiven Majorisierung mutierte (Hegel: Ästhetik), zitiert nach Welsch (1996: 530ff.).<br />
103 Vgl. Wittgenstein, L. (1984): Philosophische Untersuchungen, in: ders. (1984), Werkausgabe,<br />
Bd. I, Frankfurt, S. 225-580, zitiert nach Welsch (1996: 396ff.).<br />
119