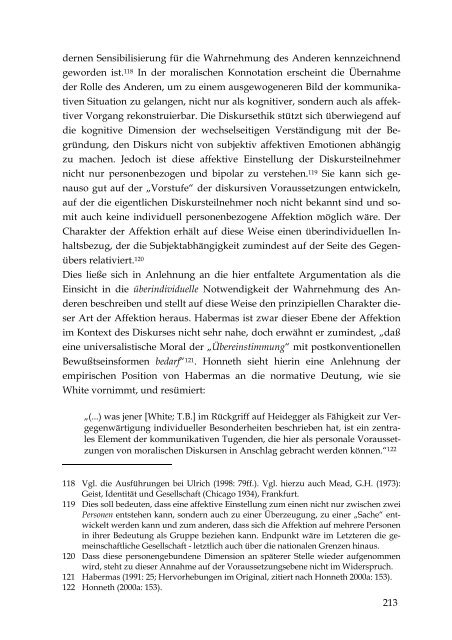TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
TRANSVERSALE WIRTSCHAFTSETHIK - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dernen Sensibilisierung für die Wahrnehmung des Anderen kennzeichnend<br />
geworden ist. 118 In der moralischen Konnotation erscheint die Übernahme<br />
der Rolle des Anderen, um zu einem ausgewogeneren Bild der kommunikativen<br />
Situation zu gelangen, nicht nur als kognitiver, sondern auch als affektiver<br />
Vorgang rekonstruierbar. Die Diskursethik stützt sich überwiegend auf<br />
die kognitive Dimension der wechselseitigen Verständigung mit der Begründung,<br />
den Diskurs nicht von subjektiv affektiven Emotionen abhängig<br />
zu machen. Jedoch ist diese affektive Einstellung der Diskursteilnehmer<br />
nicht nur personenbezogen und bipolar zu verstehen. 119 Sie kann sich genauso<br />
gut auf der „Vorstufe“ der diskursiven Voraussetzungen entwickeln,<br />
auf der die eigentlichen Diskursteilnehmer noch nicht bekannt sind und somit<br />
auch keine individuell personenbezogene Affektion möglich wäre. Der<br />
Charakter der Affektion erhält auf diese Weise einen überindividuellen Inhaltsbezug,<br />
der die Subjektabhängigkeit zumindest auf der Seite des Gegenübers<br />
relativiert. 120<br />
Dies ließe sich in Anlehnung an die hier entfaltete Argumentation als die<br />
Einsicht in die überindividuelle Notwendigkeit der Wahrnehmung des Anderen<br />
beschreiben und stellt auf diese Weise den prinzipiellen Charakter dieser<br />
Art der Affektion heraus. Habermas ist zwar dieser Ebene der Affektion<br />
im Kontext des Diskurses nicht sehr nahe, doch erwähnt er zumindest, „daß<br />
eine universalistische Moral der „Übereinstimmung“ mit postkonventionellen<br />
Bewußtseinsformen bedarf“ 121. Honneth sieht hierin eine Anlehnung der<br />
empirischen Position von Habermas an die normative Deutung, wie sie<br />
White vornimmt, und resümiert:<br />
„(...) was jener [White; T.B.] im Rückgriff auf Heidegger als Fähigkeit zur Vergegenwärtigung<br />
individueller Besonderheiten beschrieben hat, ist ein zentrales<br />
Element der kommunikativen Tugenden, die hier als personale Voraussetzungen<br />
von moralischen Diskursen in Anschlag gebracht werden können.“ 122<br />
118 Vgl. die Ausführungen bei Ulrich (1998: 79ff.). Vgl. hierzu auch Mead, G.H. (1973):<br />
Geist, Identität und Gesellschaft (Chicago 1934), Frankfurt.<br />
119 Dies soll bedeuten, dass eine affektive Einstellung zum einen nicht nur zwischen zwei<br />
Personen entstehen kann, sondern auch zu einer Überzeugung, zu einer „Sache“ entwickelt<br />
werden kann und zum anderen, dass sich die Affektion auf mehrere Personen<br />
in ihrer Bedeutung als Gruppe beziehen kann. Endpunkt wäre im Letzteren die gemeinschaftliche<br />
Gesellschaft - letztlich auch über die nationalen Grenzen hinaus.<br />
120 Dass diese personengebundene Dimension an späterer <strong>St</strong>elle wieder aufgenommen<br />
wird, steht zu dieser Annahme auf der Voraussetzungsebene nicht im Widerspruch.<br />
121 Habermas (1991: 25; Hervorhebungen im Original, zitiert nach Honneth 2000a: 153).<br />
122 Honneth (2000a: 153).<br />
213