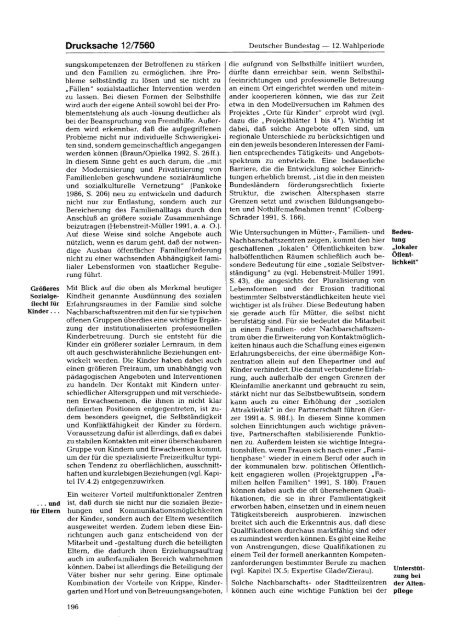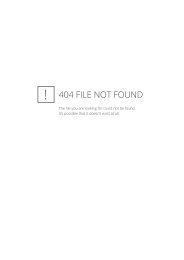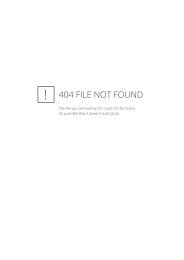Fünfter Familienbericht - Deutscher Bundestag
Fünfter Familienbericht - Deutscher Bundestag
Fünfter Familienbericht - Deutscher Bundestag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Größeres<br />
Sozialgeflecht<br />
für<br />
Kinder .. .<br />
... und<br />
für Eltern<br />
Drucksache 12/7560<br />
sungskompetenzen der Betroffenen zu stärken<br />
und den Familien zu ermöglichen, ihre Probleme<br />
selbständig zu lösen und sie nicht zu<br />
„Fällen" sozialstaatlicher Intervention werden<br />
zu lassen. Bei diesen Formen der Selbsthilfe<br />
wird auch der eigene Anteil sowohl bei der Problementstehung<br />
als auch -lösung deutlicher als<br />
bei der Beanspruchung von Fremdhilfe. Außerdem<br />
wird erkennbar, daß die aufgegriffenen<br />
Probleme nicht nur individuelle Schwierigkeiten<br />
sind, sondern gemeinschaftlich angegangen<br />
werden können (Braun/Opielka 1992, S. 26 ff.).<br />
In diesem Sinne geht es auch darum, die „mit<br />
der Modernisierung und Privatisierung von<br />
Familienleben geschwundene sozialräumliche<br />
und sozialkulturelle Vernetzung" (Pankoke<br />
1986, S. 206) neu zu entwickeln und dadurch<br />
nicht nur zur Entlastung, sondern auch zur<br />
Bereicherung des Familienalltags durch den<br />
Anschluß an größere soziale Zusammenhänge<br />
beizutragen (Hebenstreit-Müller 1991, a. a. O.).<br />
Auf diese Weise sind solche Angebote auch<br />
nützlich, wenn es darum geht, daß der notwendige<br />
Ausbau öffentlicher Familienförderung<br />
nicht zu einer wachsenden Abhängigkeit familialer<br />
Lebensformen von staatlicher Regulierung<br />
führt.<br />
Mit Blick auf die oben als Merkmal heutiger<br />
Kindheit genannte Ausdünnung des sozialen<br />
Erfahrungsraumes in der Familie sind solche<br />
Nachbarschaftszentren mit den für sie typischen<br />
offenen Gruppen überdies eine wichtige Ergänzung<br />
der institutionalisierten professionellen<br />
Kinderbetreuung. Durch sie entsteht für die<br />
Kinder ein größerer sozialer Lernraum, in dem<br />
oft auch geschwisterähnliche Beziehungen entwickelt<br />
werden. Die Kinder haben dabei auch<br />
einen größeren Freiraum, um unabhängig von<br />
pädagogischen Angeboten und Interventionen<br />
zu handeln. Der Kontakt mit Kindern unterschiedlicher<br />
Altersgruppen und mit verschiedenen<br />
Erwachsenenen, die ihnen in nicht klar<br />
definierten Positionen entgegentreten, ist zudem<br />
besonders geeignet, die Selbständigkeit<br />
und Konfliktfähigkeit der Kinder zu fördern.<br />
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß es dabei<br />
zu stabilen Kontakten mit einer überschaubaren<br />
Gruppe von Kindern und Erwachsenen kommt,<br />
um der für die spezialisierte Freizeitkultur typischen<br />
Tendenz zu oberflächlichen, ausschnitthaften<br />
und kurzlebigen Beziehungen (vgl. Kapitel<br />
IV. 4.2) entgegenzuwirken.<br />
Ein weiterer Vorteil multifunktionaler Zentren<br />
ist, daß durch sie nicht nur die sozialen Beziehungen<br />
und Kommunikationsmöglichkeiten<br />
der Kinder, sondern auch der Eltern wesentlich<br />
ausgeweitet werden. Zudem leben diese Einrichtungen<br />
auch ganz entscheidend von der<br />
Mitarbeit und -gestaltung durch die beteiligten<br />
Eltern, die dadurch ihren Erziehungsauftrag<br />
auch im außerfamilialen Bereich wahrnehmen<br />
können. Dabei ist allerdings die Beteiligung der<br />
Väter bisher nur sehr gering. Eine optimale<br />
Kombination der Vorteile von Krippe, Kindergarten<br />
und Hort und von Betreuungsangeboten,<br />
<strong>Deutscher</strong> <strong>Bundestag</strong> — 12. Wahlperiode<br />
die aufgrund von Selbsthilfe initiiert wurden,<br />
dürfte dann erreichbar sein, wenn Selbsthilfeeinrichtungen<br />
und professionelle Betreuung<br />
an einem Ort eingerichtet werden und miteinander<br />
kooperieren können, wie das zur Zeit<br />
etwa in den Modellversuchen im Rahmen des<br />
Projektes „Orte für Kinder" erprobt wird (vgl.<br />
dazu die „Projektblätter 1 bis 4"). Wichtig ist<br />
dabei, daß solche Angebote offen sind, um<br />
regionale Unterschiede zu berücksichtigen und<br />
ein den jeweils besonderen Interessen der Familien<br />
entsprechendes Tätigkeits- und Angebotsspektrum<br />
zu entwickeln. Eine bedauerliche<br />
Barriere, die die Entwicklung solcher Einrichtungen<br />
erheblich bremst, „ist die in den meisten<br />
Bundesländern förderungsrechtlich fixierte<br />
Struktur, die zwischen Altersphasen starre<br />
Grenzen setzt und zwischen Bildungsangeboten<br />
und Nothilfemaßnahmen trennt" (Colberg-<br />
Schrader 1991, S. 166).<br />
Wie Untersuchungen in Mütter-, Familien- und<br />
Nachbarschaftszentren zeigen, kommt den hier<br />
geschaffenen „lokalen" Öffentlichkeiten bzw.<br />
halböffentlichen Räumen schließlich auch besondere<br />
Bedeutung für eine „soziale Selbstverständigung"<br />
zu (vgl. Hebenstreit-Müller 1991,<br />
S. 43), die angesichts der Pluralisierung von<br />
Lebensformen und der Erosion traditional<br />
bestimmter Selbstverständlichkeiten heute viel<br />
wichtiger ist als früher. Diese Bedeutung haben<br />
sie gerade auch für Mütter, die selbst nicht<br />
berufstätig sind. Für sie bedeutet die Mitarbeit<br />
in einem Familien- oder Nachbarschaftszentrum<br />
über die Erweiterung von Kontaktmöglichkeiten<br />
hinaus auch die Schaffung eines eigenen<br />
Erfahrungsbereichs, der eine übermäßige Konzentration<br />
allein auf den Ehepartner und auf<br />
Kinder verhindert. Die damit verbundene Erfahrung,<br />
auch außerhalb der engen Grenzen der<br />
Kleinfamilie anerkannt und gebraucht zu sein,<br />
stärkt nicht nur das Selbstbewußtsein, sondern<br />
kann auch zu einer Erhöhung der „sozialen<br />
Attraktivität" in der Partnerschaft führen (Gerzer<br />
1991 a, S. 98f.). In diesem Sinne kommen<br />
solchen Einrichtungen auch wichtige präventive,<br />
Partnerschaften stabilisierende Funktionen<br />
zu. Außerdem leisten sie wichtige Integrationshilfen,<br />
wenn Frauen sich nach einer „Familienphase"<br />
wieder in einem Beruf oder auch in<br />
der kommunalen bzw. politischen Öffentlichkeit<br />
engagieren wollen (Projektgruppen „Familien<br />
helfen Familien" 1991, S. 180). Frauen<br />
können dabei auch die oft übersehenen Qualifikationen,<br />
die sie in ihrer Familientätigkeit<br />
erworben haben, einsetzen und in einem neuen<br />
Tätigkeitsbereich ausprobieren. Inzwischen<br />
breitet sich auch die Erkenntnis aus, daß diese<br />
Qualifikationen durchaus marktfähig sind oder<br />
es zumindest werden können. Es gibt eine Reihe<br />
von Anstrengungen, diese Qualifikationen zu<br />
einem Teil der formell anerkannten Kompetenzanforderungen<br />
bestimmter Berufe zu machen<br />
(vgl. Kapitel IX. 5; Expertise Glade/Zierau).<br />
Solche Nachbarschafts- oder Stadtteilzentren<br />
können auch eine wichtige Funktion bei der<br />
Bedeutung<br />
„lokaler<br />
Öffentlichkeit"<br />
Unterstützung<br />
bei<br />
der Altenpflege