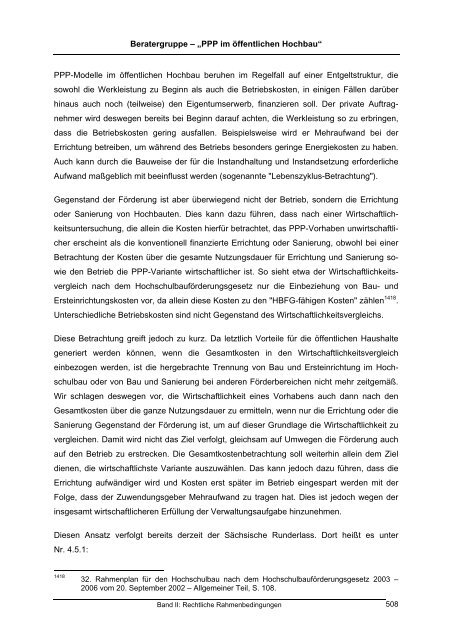Gutachten "PPP im öffentlichen Hochbau" - Band 2 ... - BMVBS
Gutachten "PPP im öffentlichen Hochbau" - Band 2 ... - BMVBS
Gutachten "PPP im öffentlichen Hochbau" - Band 2 ... - BMVBS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Beratergruppe – „<strong>PPP</strong> <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Hochbau“<br />
<strong>PPP</strong>-Modelle <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Hochbau beruhen <strong>im</strong> Regelfall auf einer Entgeltstruktur, die<br />
sowohl die Werkleistung zu Beginn als auch die Betriebskosten, in einigen Fällen darüber<br />
hinaus auch noch (teilweise) den Eigentumserwerb, finanzieren soll. Der private Auftragnehmer<br />
wird deswegen bereits bei Beginn darauf achten, die Werkleistung so zu erbringen,<br />
dass die Betriebskosten gering ausfallen. Beispielsweise wird er Mehraufwand bei der<br />
Errichtung betreiben, um während des Betriebs besonders geringe Energiekosten zu haben.<br />
Auch kann durch die Bauweise der für die Instandhaltung und Instandsetzung erforderliche<br />
Aufwand maßgeblich mit beeinflusst werden (sogenannte "Lebenszyklus-Betrachtung").<br />
Gegenstand der Förderung ist aber überwiegend nicht der Betrieb, sondern die Errichtung<br />
oder Sanierung von Hochbauten. Dies kann dazu führen, dass nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung,<br />
die allein die Kosten hierfür betrachtet, das <strong>PPP</strong>-Vorhaben unwirtschaftlicher<br />
erscheint als die konventionell finanzierte Errichtung oder Sanierung, obwohl bei einer<br />
Betrachtung der Kosten über die gesamte Nutzungsdauer für Errichtung und Sanierung sowie<br />
den Betrieb die <strong>PPP</strong>-Variante wirtschaftlicher ist. So sieht etwa der Wirtschaftlichkeitsvergleich<br />
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz nur die Einbeziehung von Bau- und<br />
Ersteinrichtungskosten vor, da allein diese Kosten zu den "HBFG-fähigen Kosten" zählen 1418 .<br />
Unterschiedliche Betriebskosten sind nicht Gegenstand des Wirtschaftlichkeitsvergleichs.<br />
Diese Betrachtung greift jedoch zu kurz. Da letztlich Vorteile für die <strong>öffentlichen</strong> Haushalte<br />
generiert werden können, wenn die Gesamtkosten in den Wirtschaftlichkeitsvergleich<br />
einbezogen werden, ist die hergebrachte Trennung von Bau und Ersteinrichtung <strong>im</strong> Hochschulbau<br />
oder von Bau und Sanierung bei anderen Förderbereichen nicht mehr zeitgemäß.<br />
Wir schlagen deswegen vor, die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens auch dann nach den<br />
Gesamtkosten über die ganze Nutzungsdauer zu ermitteln, wenn nur die Errichtung oder die<br />
Sanierung Gegenstand der Förderung ist, um auf dieser Grundlage die Wirtschaftlichkeit zu<br />
vergleichen. Damit wird nicht das Ziel verfolgt, gleichsam auf Umwegen die Förderung auch<br />
auf den Betrieb zu erstrecken. Die Gesamtkostenbetrachtung soll weiterhin allein dem Ziel<br />
dienen, die wirtschaftlichste Variante auszuwählen. Das kann jedoch dazu führen, dass die<br />
Errichtung aufwändiger wird und Kosten erst später <strong>im</strong> Betrieb eingespart werden mit der<br />
Folge, dass der Zuwendungsgeber Mehraufwand zu tragen hat. Dies ist jedoch wegen der<br />
insgesamt wirtschaftlicheren Erfüllung der Verwaltungsaufgabe hinzunehmen.<br />
Diesen Ansatz verfolgt bereits derzeit der Sächsische Runderlass. Dort heißt es unter<br />
Nr. 4.5.1:<br />
1418 32. Rahmenplan für den Hochschulbau nach dem Hochschulbauförderungsgesetz 2003 –<br />
2006 vom 20. September 2002 – Allgemeiner Teil, S. 108.<br />
<strong>Band</strong> II: Rechtliche Rahmenbedingungen 508