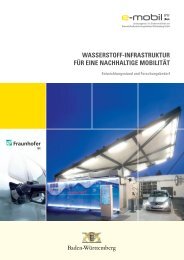Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6.1 Erwarteter Energiebedarf <strong>von</strong> Elektrofahrzeugen, Ladestrategien, potenzielle Integration <strong>von</strong> Windenergie<br />
Ladeleistung<br />
Die aus dem Netz bezogene elektrische Leistung ist zum einen durch die Leistung des Ladeanschlusses<br />
begrenzt, zum anderen durch die Leistung, die die Batterie maximal aufnehmen<br />
kann. Bei den heute üblichen Anschlussleistungen für Wohnungen ist ein Ladeanschluss<br />
am Wohnungsparkplatz <strong>von</strong> einphasig oder dreiphasig 230 V 16 A fast überall möglich<br />
(ggf. muss ein neues Kabel <strong>von</strong> der Elektro-Verteilung der Wohnung zum Ladeanschluss<br />
verlegt werden), höhere Leistungen (maximal dreiphasig 25 A) sind nicht immer möglich und<br />
bedürfen meist der Genehmigung des Verteilnetzbetreibers. Die Batterie eines xEV ist auf<br />
die Motorleistung ausgelegt, so dass die maximal zulässige Ladeleistung in der Regel höher<br />
ist als die elektrische Leistung des Netzanschlusses am Wohnungsparkplatz. Lediglich an<br />
speziellen Schnellladestationen kann die maximal mögliche Ladeleistung der Batterie erreicht<br />
werden.<br />
Ein Ladegerät entnimmt prinzipiell einen nicht sinusförmigen Strom aus dem Netz. Zwar darf<br />
der zulässige Anteil der Oberwellen nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) nicht überschritten<br />
werden, aus technischen Gründen kann dennoch kein Leistungsfaktor 1 erreicht werden.<br />
Hier wird ein Leistungsfaktor <strong>von</strong> 0,9 angenommen (bei verschiedenen derzeit marktgängigen<br />
Industrieladegeräten liegt der Leistungsfaktor in dieser Größenordnung), daraus folgt,<br />
dass über den Netzanschluss eine Wirkleistung <strong>von</strong> 3,3 kW (einphasig) oder 9,9 kW (dreiphasig)<br />
bezogen werden kann. Wir gehen da<strong>von</strong> aus, dass im Jahr 2020 die überwiegende<br />
Zahl der Ladeanschlüsse eine Leistung <strong>von</strong> 3,3 kW hat, im Jahr 2030 werden Ladeanschlüsse<br />
<strong>mit</strong> 9,9 kW modelliert.<br />
Tagesfahrstrecken<br />
Der tägliche Energiebedarf E Bestand aller Elektrofahrzeuge im Bestand ist die Summe der Produkte<br />
Tagesfahrstrecke TFS i des Fahrzeugs i mal spezifischer Energieverbrauch E spez,i des<br />
Fahrzeugs i über alle Fahrzeuge. Unter der Annahme, dass die Verteilung der TFS bei allen<br />
EV-Typen gleich ist, ist der Energiebedarf gleich der <strong>mit</strong>tleren TFS mal Anzahl Fahrzeuge<br />
n xEV mal <strong>mit</strong>tlerem Verbrauch E xEV (Gleichung (30)):<br />
n<br />
Bestand, pro Tag = i⋅<br />
spez,<br />
i<br />
i=<br />
1<br />
(30)<br />
E TFS E<br />
( BEV BEV REEV REEV PHEV PHEV )<br />
= TFS ⋅ n ⋅ E + n ⋅ E + n ⋅E<br />
Die Verteilung der TFS wird aus der Datenbank „Mobilität in Deutschland 2008“ (MiD 2008)<br />
[infas & DLR, 2009] entnommen. In der Datenbank MiD 2008 ist entweder eine TFS größer<br />
als Null eingetragen, oder „unplausibler Wert“, oder der Wert für „keine Angabe“. „Keine Angabe“<br />
kann sowohl bedeuten, dass das Fahrzeug am Stichtag nicht genutzt wurde, als auch,<br />
dass die Befragten über die Nutzung des Fahrzeugs keine Angabe gemacht haben. Der Anteil<br />
der tatsächlich nicht genutzten Fahrzeuge ist unbekannt. Je größer der Anteil der nicht<br />
genutzten Fahrzeuge am Gesamtbestand ist (bei gleicher Verteilung der TFS der genutzten<br />
Fahrzeuge), umso geringer ist der gesamte Energiebedarf.<br />
Seite 119