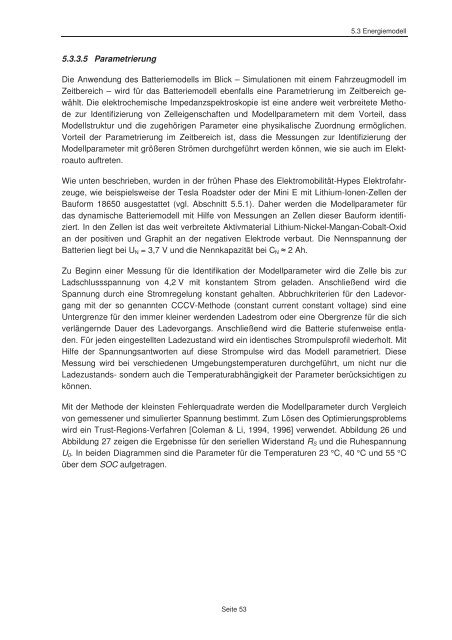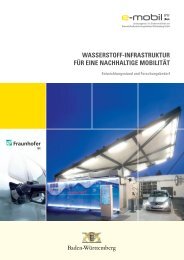Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5.3 Energiemodell<br />
5.3.3.5 Parametrierung<br />
Die Anwendung des Batteriemodells im Blick – Simulationen <strong>mit</strong> einem Fahrzeugmodell im<br />
Zeitbereich – wird für das Batteriemodell ebenfalls eine Parametrierung im Zeitbereich gewählt.<br />
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie ist eine andere weit verbreitete Methode<br />
zur Identifizierung <strong>von</strong> Zelleigenschaften und Modellparametern <strong>mit</strong> dem Vorteil, dass<br />
Modellstruktur und die zugehörigen Parameter eine physikalische Zuordnung ermöglichen.<br />
Vorteil der Parametrierung im Zeitbereich ist, dass die Messungen zur Identifizierung der<br />
Modellparameter <strong>mit</strong> größeren Strömen durchgeführt werden können, wie sie auch im Elektroauto<br />
auftreten.<br />
Wie unten beschrieben, wurden in der frühen Phase des Elektromobilität-Hypes Elektrofahrzeuge,<br />
wie beispielsweise der Tesla Roadster oder der Mini E <strong>mit</strong> Lithium-Ionen-Zellen der<br />
Bauform 18650 ausgestattet (vgl. Abschnitt 5.5.1). Daher werden die Modellparameter für<br />
das dynamische Batteriemodell <strong>mit</strong> Hilfe <strong>von</strong> Messungen an Zellen dieser Bauform identifiziert.<br />
In den Zellen ist das weit verbreitete Aktivmaterial Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid<br />
an der positiven und Graphit an der negativen Elektrode verbaut. Die Nennspannung der<br />
Batterien liegt bei U N = 3,7 V und die Nennkapazität bei C N 2 Ah.<br />
Zu Beginn einer Messung für die Identifikation der Modellparameter wird die Zelle bis zur<br />
Ladschlussspannung <strong>von</strong> 4,2 V <strong>mit</strong> konstantem Strom geladen. Anschließend wird die<br />
Spannung durch eine Stromregelung konstant gehalten. Abbruchkriterien für den Ladevorgang<br />
<strong>mit</strong> der so genannten CCCV-Methode (constant current constant voltage) sind eine<br />
Untergrenze für den immer kleiner werdenden Ladestrom oder eine Obergrenze für die sich<br />
verlängernde Dauer des Ladevorgangs. Anschließend wird die Batterie stufenweise entladen.<br />
Für jeden eingestellten Ladezustand wird ein identisches Strompulsprofil wiederholt. Mit<br />
Hilfe der Spannungsantworten auf diese Strompulse wird das Modell parametriert. Diese<br />
Messung wird bei verschiedenen Umgebungstemperaturen durchgeführt, um nicht nur die<br />
Ladezustands- sondern auch die Temperaturabhängigkeit der Parameter berücksichtigen zu<br />
können.<br />
Mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate werden die Modellparameter durch Vergleich<br />
<strong>von</strong> gemessener und simulierter Spannung bestimmt. Zum Lösen des Optimierungsproblems<br />
wird ein Trust-Regions-Verfahren [Coleman & Li, 1994, 1996] verwendet. Abbildung 26 und<br />
Abbildung 27 zeigen die Ergebnisse für den seriellen Widerstand R S und die Ruhespannung<br />
U 0 . In beiden Diagrammen sind die Parameter für die Temperaturen 23 °C, 40 °C und 55 °C<br />
über dem SOC aufgetragen.<br />
Seite 53