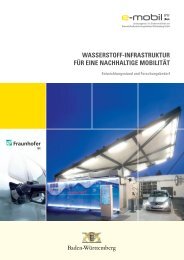Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Netzintegration von Fahrzeugen mit elektrifizierten ... - JUWEL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6. Chancen und Risiken der <strong>Netzintegration</strong> <strong>von</strong> Elektrofahrzeugen auf verschiedenen Spannungsebenen<br />
Bei Anschluss des Kabels erkennt diese Schutzeinrichtung, ob Spannung anliegt, und ebenso,<br />
ob ein Schutzleiter vorhanden ist, außerdem ist eine weitere Fehlerstromschutzeinrichtung<br />
in die Box integriert. Der Schutzleiteranschluss, verbunden <strong>mit</strong> sämtlichen berührbaren<br />
und leitfähigen Teilen, wird zwischen der Kontrollbox und der Ladesteckdose permanent<br />
überwacht. In Ergänzung zur zweiten Ladebetriebsart wird das Fahrzeug im dritten Typ über<br />
ein in das Elektrofahrzeug integriertes Bordladegerät sowie einem in die Ladestation integrierten<br />
Lade-Controller <strong>mit</strong> dem Netz verbunden. Bei der für die größten Leistungen und die<br />
Schnellladung konzipierten vierten Betriebsart wird das Elektrofahrzeug <strong>mit</strong> Gleichstrom geladen,<br />
der <strong>von</strong> einem stationären Umrichter geliefert wird.<br />
Bei einer Betriebsspannung <strong>von</strong> 230 V bzw. 400 V im Niederspannungsnetz ergeben sich<br />
Ladeleistungen zwischen 3,7 kW und maximal 277,1 kW. Da Schnellladung gemäß Ladebetriebsart<br />
3 und 4 zu drastischen Spannungsfällen am Hausanschluss führen würde, liegt der<br />
Fokus der Untersuchung zunächst auf den ersten beiden Ladebetriebsarten, die eine Normalladung<br />
gemäß der bisher betrachteten Ladestrategien, nach Ankunft des Fahrzeuges zu<br />
Hause, oder während der Nacht, ermöglichen. Bei den Ladeleistungen wurde nicht wie in<br />
den Kapiteln zuvor <strong>mit</strong> einer um den Leistungsfaktor 0,9 reduzierten Ladeleistung gerechnet<br />
(siehe Abschnitt 6.1.1.2), da hier Belastungsgrenzen im Sinne einer Worst-Case-<br />
Abschätzung er<strong>mit</strong>telt werden sollen.<br />
Typ Beschreibung Ladeleistung<br />
1<br />
2<br />
Anschluss an ein- oder dreiphasiges Wechselstromnetz für<br />
Bemessungsströme bis 16 A<br />
Ergänzend zu Klasse 1 sind Geräteströme bis 32 A zugelassen<br />
und ein Pilotkontakt erforderlich<br />
3,7 kW (einphasig)<br />
11,1 kW (dreiphasig)<br />
7,4 kW (einphasig)<br />
22,2 kW (dreiphasig)<br />
3 Betriebsart für Wechselstrom – Schnellladung bis 250 A 173,2 kW (bei 400 V)<br />
4 Vorgesehen für Schnellladung <strong>mit</strong> Gleichstrom bis 400 A 277,1 kW (bei 400 V)<br />
Tabelle 38: Ladebetriebsarten nach DIN EN 61851-1<br />
DIN EN 62196-1 (VDE 0623 Teil 5) legt die Anforderungen an die Stecker fest, welche durch<br />
DIN EN 61851-1 (VDE 0122) beschrieben worden sind und gilt für AC-Ladungen bis 690V<br />
und 250A als auch für DC-Ladungen bis 600V und 400A. Es werden jedoch keine physischen<br />
Dimensionen für die Ladebuchse vorgegeben, sondern auf DIN EN 60309-1 (VDE<br />
0623-1) verwiesen, welche im Allgemeinen vorgibt, wie Stecker und Kupplungen aufgebaut<br />
sein müssen [DIN, 2007, 2010b].<br />
Ein Stecker, der <strong>mit</strong> einem Leistungsspektrum <strong>von</strong> einphasig 16A bis dreiphasig 63A bei<br />
230V oder 400V die Anforderungen der Ladebetriebsarten 1 und 2 erfüllt, wurde vom Systemhersteller<br />
Mennekes in Kooperation <strong>mit</strong> Daimler und RWE entwickelt [MENNEKES Elektrotechnik<br />
GmbH & Co. KG, 2012b]. Dieser Stecker wurde zur Normung beim IEC vorgestellt<br />
und in der IEC 62196-2 genormt, welche voraussichtlich im September 2012 gültig wird. Neben<br />
drei Außenleitern, der Masse und dem Nullleiter sind eine Näherungserkennung und ein<br />
Schaltpilot vorgesehen. Die Näherungserkennung hat die Aufgabe, die Stromtragfähigkeit<br />
der Ladeleitung festzulegen und die Wegfahrsperre beim Ladevorgang zu aktivieren. Die<br />
Funktionsweise des Schaltpilots ist ebenso in DIN EN 61851-1 definiert und umfasst im We-<br />
Seite 164