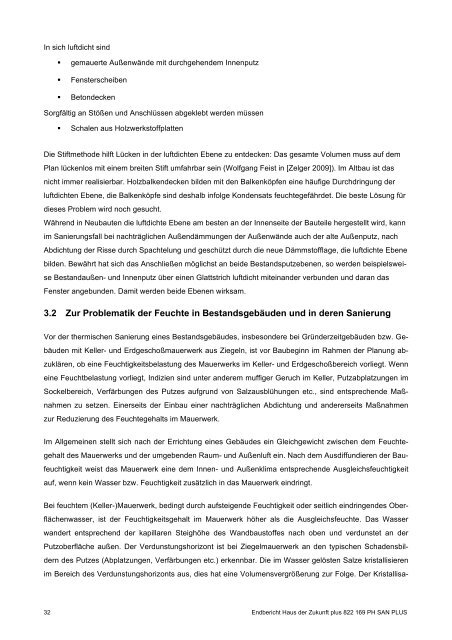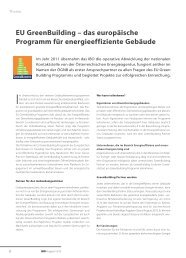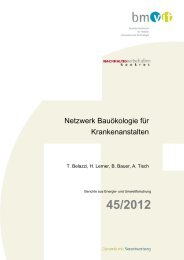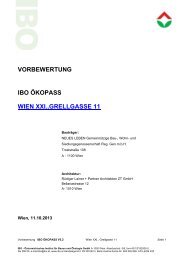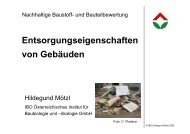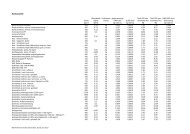- Seite 1 und 2: PH-Sanierungsbauteilkatalog: Zweite
- Seite 3: PH-Sanierungsbauteilkatalog. Zweite
- Seite 6 und 7: INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG - Z
- Seite 8 und 9: INHALTSVERZEICHNIS AUSFÜHRLICH 1 E
- Seite 10 und 11: 4.4 GEBÄUDE DER 70ER JAHRE .......
- Seite 12 und 13: 7 SCHADSTOFFE IN BESTEHENDEN GEBÄU
- Seite 14 und 15: Kurzfassung Ausgangssituation/Motiv
- Seite 16 und 17: 1 Einleitung - zukunftsfähig moder
- Seite 18 und 19: gestellungen, Schadstofferkundungen
- Seite 20 und 21: 2.2 Beschreibung der Vorarbeiten zu
- Seite 22 und 23: 2.3.2.3 Indikatoren Überblick In d
- Seite 24 und 25: 2.3.2.6 Zusammenführung auf Bautei
- Seite 26 und 27: Konstruktion gesteuert werden. In d
- Seite 28 und 29: 1. Jänner. Als Ergebnis werden im
- Seite 30 und 31: 3 Grundlagen der thermischen Sanier
- Seite 34 und 35: die auf die objektspezifischen Gege
- Seite 36 und 37: §� Angaben zu flankierenden Maß
- Seite 38 und 39: werk durch Temperaturspannungen inf
- Seite 40 und 41: Zeit vollständig verlegt und verli
- Seite 42 und 43: Abb. 5 sind zwei typische Kellerfen
- Seite 44 und 45: Fensteröffnungsgröße 0,002 m² F
- Seite 46 und 47: Jahr annähernd gleich feucht bleib
- Seite 48 und 49: Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 50 und 51: Abb. 14: Jahresverlauf von Temperat
- Seite 52 und 53: Alle Lüftungsvarianten werden jewe
- Seite 54 und 55: 3.3.3 Ergebnisse bei 0,1-fachem Luf
- Seite 56 und 57: 3.3.5 Ergebnisse bei 0,4-fachem Luf
- Seite 58 und 59: Jahresverlauf des Kellerklimas info
- Seite 60 und 61: Abb. 22: Temperatur und relative Lu
- Seite 62 und 63: Abb. 25: Wärmestrom durch die Kell
- Seite 64 und 65: Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 66 und 67: Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 68 und 69: Abb. 31: Temperatur und relative Lu
- Seite 70 und 71: Abb. 35: Wärmestrom durch die Kell
- Seite 72 und 73: Luftwechsel 0,8/h Abb. 37: Wasserge
- Seite 74 und 75: Abb. 40: Temperatur und relative Lu
- Seite 76 und 77: Abb. 44: Wärmeverluste der Innenra
- Seite 78 und 79: Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 80 und 81: Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 82 und 83:
Abb. 52: Absolute Luftfeuchte bei g
- Seite 84 und 85:
Dämmung der Außenhülle mittels A
- Seite 86 und 87:
Abb. 58: Jahresverlauf von relative
- Seite 88 und 89:
Abb. 62: Wärmestrom durch die Kell
- Seite 90 und 91:
Temperaturverlauf Der Durchfeuchtun
- Seite 92 und 93:
Risiko für Schimmelpilzwachstum Ei
- Seite 94 und 95:
Abb. 70: Jahresverlauf von relative
- Seite 96 und 97:
Abb. 72: Innen- und Außenklima anh
- Seite 98 und 99:
Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 100 und 101:
Abb. 77: Feuchtegehalt der Kellerlu
- Seite 102 und 103:
Wärmerückgewinnung bei einem Kell
- Seite 104 und 105:
Abb. 83: Feuchtegehalt der Kellerlu
- Seite 106 und 107:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 108 und 109:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 110 und 111:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 112 und 113:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 114 und 115:
schürze und die Schirmdämmung ein
- Seite 116 und 117:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 118 und 119:
Relative Luftfeuchte dimensionslos
- Seite 120 und 121:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 122 und 123:
Dämmung an der Oberseite der Boden
- Seite 124 und 125:
Wassergehalt in kg/m³ Relative Luf
- Seite 126 und 127:
Die folgenden Diagramme zeigen die
- Seite 128 und 129:
Durch eine gut geplante und ausgef
- Seite 130 und 131:
schlusses bestimmte Randbedingungen
- Seite 132 und 133:
§� Dämmstoffe mit einem µ-Wert
- Seite 134 und 135:
§� 4 Dämmstoffe: EPS, Mineralwo
- Seite 136 und 137:
Eine dauerhaft luftdichte innere Sc
- Seite 138 und 139:
§� Die direkte Messung der Holzf
- Seite 140 und 141:
Die Messergebnisse in einem Testhau
- Seite 142 und 143:
§� Eintrag von Regenwasser in de
- Seite 144 und 145:
Schichten durchdringen. Über die V
- Seite 146 und 147:
Abb. 111: Langjähriger Monatsmitte
- Seite 148 und 149:
Abb. 114: Zeitlicher Verlauf der In
- Seite 150 und 151:
Abb. 117: Temperatur und relative L
- Seite 152 und 153:
Konstruktion mit Innendämmung und
- Seite 154 und 155:
Konstruktion mit Innendämmung und
- Seite 156 und 157:
3.4.5 Abschätzung des zusätzliche
- Seite 158 und 159:
Für den kritischsten Punkt an der
- Seite 160 und 161:
Nachstehend sind die Ergebnisse im
- Seite 162 und 163:
Die Einsparung beträgt je nach Var
- Seite 164 und 165:
Fall 3: Das Versagensrisiko kann nu
- Seite 166 und 167:
3.4.7 Beispielhafte Anschlüsse mit
- Seite 168 und 169:
3.4.7.2 Außenwand Vollziegel Innen
- Seite 170 und 171:
3.4.7.3 Außenwand mit Innendämmun
- Seite 172 und 173:
3.4.7.4 Außenwand mit Innendämmun
- Seite 174 und 175:
3.4.7.5 Außenwand Kalkstein mit In
- Seite 176 und 177:
3.4.7.6 Außenwand mit Innendämmun
- Seite 178 und 179:
3.4.7.7 Außenwand mit Innendämmun
- Seite 180 und 181:
3.4.7.8 Außenwand Vollziegel mit k
- Seite 182 und 183:
3.4.7.9 Außenwand Vollziegel mit I
- Seite 184 und 185:
3.4.7.10 Außenwand mit kapillarlei
- Seite 186 und 187:
3.4.7.11 Außenwand mit Innendämmu
- Seite 188 und 189:
3.4.8 Schlussfolgerung Innendämmun
- Seite 190 und 191:
3.5.1 Biozide in Fassadenbeschichtu
- Seite 192 und 193:
estätigt werden. Jedoch zeigte sic
- Seite 194 und 195:
3.6 Rekonstruktion des ursprünglic
- Seite 196 und 197:
leinstehend, andere in gekoppelter
- Seite 198 und 199:
§� Die Putzstärken können star
- Seite 200 und 201:
4.1.2.1 Kellerdecken Kellerdecken w
- Seite 202 und 203:
Vollziegelinnenwand tragend §� D
- Seite 204 und 205:
4.1.2.4 Geschoßdecke Geschoßdecke
- Seite 206 und 207:
Für die Eindeckung wurden meist Da
- Seite 208 und 209:
4.1.5 Details Sockel: Außenwand -
- Seite 210 und 211:
4.1.5.2 Außenwand mit WDVS, erdber
- Seite 212 und 213:
4.1.5.3 Außenwand mit WDVS, Kappen
- Seite 214 und 215:
4.1.6 Innenwand - Kellerdecke 4.1.6
- Seite 216 und 217:
4.1.7 Sockel: Außenwand - Erdberü
- Seite 218 und 219:
4.1.7.2 Außenwand WDVS, erdberühr
- Seite 220 und 221:
4.1.7.3 Außenwand WDVS, Schirmdäm
- Seite 222 und 223:
4.1.7.4 Außenwand Kalkstein WDVS,
- Seite 224 und 225:
4.1.8 Sockel: Innenwand - erdberüh
- Seite 226 und 227:
4.1.8.2 Innenwand Vollziegel - erdb
- Seite 228 und 229:
4.1.9 Zwischengeschoße: Außenwand
- Seite 230 und 231:
4.1.10 Zwischengeschoße: Außenwan
- Seite 232 und 233:
4.1.11 Attika: Außenwand - Dach un
- Seite 234 und 235:
4.1.11.2 Feuerwand Vollziegel verpu
- Seite 236 und 237:
4.1.12 Attika: Außenwand - Dach be
- Seite 238 und 239:
4.1.13 Attika: Außenwand - Terrass
- Seite 240 und 241:
4.1.13.2 Terrassentür - Terrasse V
- Seite 242 und 243:
4.1.13.3 Außenwand mit WDVS - Ober
- Seite 244 und 245:
4.1.13.4 Außenwand mit WDVS - Ober
- Seite 246 und 247:
4.1.13.5 Außenwand mit WDVS - Ober
- Seite 248 und 249:
4.1.14 Dach: Innenwand - Oberste Ge
- Seite 250 und 251:
4.1.14.2 Innenwand tragend Vollzieg
- Seite 252 und 253:
4.1.15 Fenster: Außenwand - Fenste
- Seite 254 und 255:
4.1.15.2 Außenwand mit WDVS abgesc
- Seite 256 und 257:
4.1.15.3 Vollziegelwand WDVS, Kaste
- Seite 258 und 259:
4.1.15.4 Vollziegelwand WDVS, Kaste
- Seite 260 und 261:
4.2 Gebäude errichtet 1920 bis 195
- Seite 262 und 263:
4.2.1.4 Innenwände Siehe Zeit vor
- Seite 264 und 265:
4.2.1.8 Fenster Fenster sind je nac
- Seite 266 und 267:
4.2.4 Sockel: Außenwand - Kellerde
- Seite 268 und 269:
4.2.4.2 Außenwand Vollziegel mit F
- Seite 270 und 271:
4.2.5 Attika: Außenwand - Dach unb
- Seite 272 und 273:
4.2.6 Fenster: Außenwand - Fenster
- Seite 274 und 275:
4.3 Gebäude der 50er und 60er Jahr
- Seite 276 und 277:
4.3.1.2 Kellerdecke Kellerdecken we
- Seite 278 und 279:
4.3.1.5 Geschoßdecken Die Geschoß
- Seite 280 und 281:
Holzverbundfenster Fenster U-Werte
- Seite 282 und 283:
4.3.4 Sockel: Außenwand - Kellerde
- Seite 284 und 285:
4.3.4.2 Ziegelsplittmauerwerk mit D
- Seite 286 und 287:
4.3.4.3 Ziegelsplittmauerwerk mit W
- Seite 288 und 289:
4.3.5 Sockel: Innenwand - Kellerdec
- Seite 290 und 291:
4.3.6 Zwischengeschoße: Außenwand
- Seite 292 und 293:
4.3.6.2 Ziegelsplittmauerwerk mit W
- Seite 294 und 295:
4.3.7 Attika: Außenwand - Dach 4.3
- Seite 296 und 297:
4.3.8 Fenster: Außenwand - Fenster
- Seite 298 und 299:
4.3.8.2 Ziegelsplittmauerwerk mit W
- Seite 300 und 301:
4.4 Gebäude der 70er Jahre Die sp
- Seite 302 und 303:
Hochlochziegel mit Klinkerziegelver
- Seite 304 und 305:
Bodenplatte mit Streifenfundament B
- Seite 306 und 307:
4.4.1.7 Dach Dächer werden vielfä
- Seite 308 und 309:
4.4.2 Typische Schadensbilder Folge
- Seite 310 und 311:
4.4.4 Sockel: Außenwand - Kellerde
- Seite 312 und 313:
4.4.4.2 Holzspanbetonwand mit Wärm
- Seite 314 und 315:
Bestand: AW-Holzspanbetonsteine, St
- Seite 316 und 317:
4.4.5 Sockel: Innenwand - Kellerdec
- Seite 318 und 319:
4.4.5.2 Holzspanbetonwand, Stahlbet
- Seite 320 und 321:
4.4.6 Sockel: Außenwand - Erdberü
- Seite 322 und 323:
4.4.7 Attika: Außenwand - Dach unb
- Seite 324 und 325:
4.4.7.2 Hochlochziegel porosiert mi
- Seite 326 und 327:
4.4.7.3 Hochlochziegel porosiert, g
- Seite 328 und 329:
4.4.7.4 Hochlochziegel porosiert mi
- Seite 330 und 331:
4.4.7.5 Hochlochziegel porosiert mi
- Seite 332 und 333:
4.4.7.6 Hochlochziegel porosiert mi
- Seite 334 und 335:
4.4.8 Attika: Außenwand - Dach beh
- Seite 336 und 337:
4.4.8.2 Holzspanbetonsteine mit WDV
- Seite 338 und 339:
4.4.8.3 Holzspanbetonwand mit Zellu
- Seite 340 und 341:
4.4.8.4 Ziegelwand 2-schalig mit Kl
- Seite 342 und 343:
4.4.8.5 Ziegelwand 2-schalig mit Kl
- Seite 344 und 345:
4.4.9 Dach: Innenwand - Dach 4.4.9.
- Seite 346 und 347:
4.4.10 Fenster: Außenwand - Fenste
- Seite 348 und 349:
4.4.11 Balkon: Außenwand - Balkon
- Seite 350 und 351:
4.4.11.2 Holzspanbetonsteine mit WD
- Seite 352 und 353:
4.4.11.3 Balkontür als Holz-Alu-Pa
- Seite 354 und 355:
4.5 Massive Gebäude der 80er Jahre
- Seite 356 und 357:
Stahlbetonwand erdberührt §� Bi
- Seite 358 und 359:
4.5.1.6 Oberste Geschoßdecke Die o
- Seite 360 und 361:
4.5.2 Typische Schadensbilder Folge
- Seite 362 und 363:
4.5.4 Details Sanierung Gebäude 80
- Seite 364 und 365:
4.5.4.2 Stahlbetonwand mit vorgefer
- Seite 366 und 367:
4.5.4.3 Ziegelwand mit vorgefertigt
- Seite 368 und 369:
4.5.4.4 Attika: Außenwand mit WDVS
- Seite 370 und 371:
4.5.4.5 Attika: Außenwand mit vorg
- Seite 372 und 373:
4.5.4.6 Attika: Ziegelwand mit WDVS
- Seite 374 und 375:
4.6 Gebäude der 80er Jahre - Ferti
- Seite 376 und 377:
4.6.2 Zwischengeschoße: Außenwand
- Seite 378 und 379:
4.6.2.2 Außenwandecke, Wand mit Le
- Seite 380 und 381:
4.6.2.3 Außenwandecke, Wand mit Ho
- Seite 382 und 383:
4.6.2.4 Außenwandanschluss vertika
- Seite 384 und 385:
4.6.3 Attika: Außenwand - Dach beh
- Seite 386 und 387:
4.6.3.2 Wand mit Leichtbau vorgefer
- Seite 388 und 389:
4.6.3.3 Dach mit Holzfertigteil ged
- Seite 390 und 391:
4.6.4 Dach - Dach 4.6.4.1 Dach mit
- Seite 392 und 393:
4.6.5 Fenster: Außenwand - Fenster
- Seite 394 und 395:
4.6.6 Tür: Außenwand - Tür 4.6.6
- Seite 396 und 397:
5 Regelquerschnitte und funktionale
- Seite 398 und 399:
Empfehlung Für die Verklebung von
- Seite 400 und 401:
°C erhitzt. Beim Oxidieren des Koh
- Seite 402 und 403:
Umwelt- und Gesundheitsaspekte Hers
- Seite 404 und 405:
Umwelt- und Gesundheitsaspekte Bei
- Seite 406 und 407:
produzent, Wasserrückhaltung, Erho
- Seite 408 und 409:
5.2.3.5 Holzfaserdämmplatten, por
- Seite 410 und 411:
lich. Sortenreine, saubere Abbruchm
- Seite 412 und 413:
5.2.3.8 Zellulosefaser-Dämmflocken
- Seite 414 und 415:
5.3.2 Übersicht Systeme Für die W
- Seite 416 und 417:
5.3.3 Wärmedämmverbundsystem 5.3.
- Seite 418 und 419:
• Feuchteschutz: Aufsteigende Feu
- Seite 420 und 421:
5.3.4 Holzkonstruktion bauseits, ve
- Seite 422 und 423:
5.3.4.5 Ökologisches Profil Herste
- Seite 424 und 425:
5.3.5 Holzkonstruktion bauseits, hi
- Seite 426 und 427:
426 Endbericht Haus der Zukunft plu
- Seite 428 und 429:
5.3.6 Holzkonstruktion vorgefertigt
- Seite 430 und 431:
5.3.6.5 Ökologische Profil Herstel
- Seite 432 und 433:
5.3.7 Holzkonstruktion vorgefertigt
- Seite 434 und 435:
5.3.7.5 Ökologisches Profil Herste
- Seite 436 und 437:
5.3.8 Holzkonstruktion inkl. Dämms
- Seite 438 und 439:
• Algen- und Schimmelpilzrisiko:
- Seite 440 und 441:
5.3.9 Holzkonstruktion inkl. Dämms
- Seite 442 und 443:
5.3.9.5 Ökologisches Profil Herste
- Seite 444 und 445:
5.3.10 Punktuelle Anker bauseits 5.
- Seite 446 und 447:
• Winddichtigkeit: Winddichte Ebe
- Seite 448 und 449:
448 Endbericht Haus der Zukunft plu
- Seite 450 und 451:
Günstig liegen vor allem Systeme m
- Seite 452 und 453:
Mineralschaumplatte Stoffliche Verw
- Seite 454 und 455:
Für die hinterlüftete Fassaden we
- Seite 456 und 457:
5.4.1.2 Wärmedämmung kapillarleit
- Seite 458 und 459:
5.4.1.4 Wärmedämmverbundsystem mi
- Seite 460 und 461:
5.4.2 Zusammenschau über den Leben
- Seite 462 und 463:
deutlich höheren Belastungen führ
- Seite 464 und 465:
5.4.2.4 Rückbau, Wiederverwertung
- Seite 466 und 467:
5.5 Wärmedämmung von Steildächer
- Seite 468 und 469:
5.5.1.2 Aufsparrendämmung bauseits
- Seite 470 und 471:
5.5.1.4 Vorfertigung Dämmstoffe: Z
- Seite 472 und 473:
5.5.2 Zusammenschau über den Leben
- Seite 474 und 475:
5.5.2.3 Nutzung und Instandhaltung
- Seite 476 und 477:
MDF-Platte Energetische Verwertung
- Seite 478 und 479:
5.6.1 Eigenschaften Bestand und Vor
- Seite 480 und 481:
5.6.2.3 Aufdopplung Warmdach auf be
- Seite 482 und 483:
5.6.2.5 Gründach siehe NBTK DAm04
- Seite 484 und 485:
5.6.2.7 Terrasse Duodach Dämmstoff
- Seite 486 und 487:
5.6.3 Zusammenschau über den Leben
- Seite 488 und 489:
Der Schallschutz der Bestandswand w
- Seite 490 und 491:
Die folgende Tabelle zeigt die Erge
- Seite 492 und 493:
5.7.1 Beschreibung und Bewertung im
- Seite 494 und 495:
5.7.1.3 Dämmstoff zwischen Holzkon
- Seite 496 und 497:
5.7.2 Zusammenschau über den Leben
- Seite 498 und 499:
ne Auflageflächen, entsprechende U
- Seite 500 und 501:
5.8 Wärmedämmung der Kellerdecke
- Seite 502 und 503:
5.8.1.2 Estrich auf druckfestem Dä
- Seite 504 und 505:
5.8.1.4 Dämmstoff zwischen Distanz
- Seite 506 und 507:
MJ/m² 100a kg SO2 e /m² 100a 1800
- Seite 508 und 509:
Vakuumdämmplatte Über die Entsorg
- Seite 510 und 511:
5.9.1 Beschreibung und Bewertung im
- Seite 512 und 513:
5.9.2 Zusammenschau über den Leben
- Seite 514 und 515:
auch herabsetzen, Faserdämmstoffe
- Seite 516 und 517:
und Putzträgersysteme werden gemei
- Seite 518 und 519:
5.10.1 Beschreibung und Bewertung i
- Seite 520 und 521:
5.10.1.3 Estrich auf druckfestem D
- Seite 522 und 523:
5.10.1.5 Dämmstoff zwischen Distan
- Seite 524 und 525:
5.10.1.7 Holzboden auf druckfestem
- Seite 526 und 527:
5.10.2 Zusammenschau über den Lebe
- Seite 528 und 529:
Staubemissionen beträchtlich sein
- Seite 530 und 531:
• 18 cm EPS-Dämmplatte + 2 cm Mi
- Seite 532 und 533:
5.11.1.2 Schüttdämmung Dämmstoff
- Seite 534 und 535:
kg SO2 e./m² 100a 5.11.2.2 Einbau
- Seite 536 und 537:
Die folgende Tabelle zeigt die Erge
- Seite 538 und 539:
5.12.1 Eigenschaften Bestand und Vo
- Seite 540 und 541:
5.12.2 Beschreibung und Bewertung i
- Seite 542 und 543:
5.12.2.2 Dämmung Balkonplatte, Abd
- Seite 544 und 545:
5.12.2.3 Balkon neu vorgestellt Sch
- Seite 546 und 547:
5.12.2.4 Balkon neu Dreibein Hinwei
- Seite 548 und 549:
5.12.2.5 Balkon neu thermisch entko
- Seite 550 und 551:
5.12.2.6 Balkon Stahlblech Hinweis:
- Seite 552 und 553:
5.12.3 Zusammenschau über den Lebe
- Seite 554 und 555:
§� Günstig schneidet vor allem
- Seite 556 und 557:
5.12.3.4 Rückbau, Wiederverwertung
- Seite 558 und 559:
zu Quecksilber-, Chrom-, Arsen- ode
- Seite 560 und 561:
§� Ab den späten 80er Jahren we
- Seite 562 und 563:
5.13.2 Beschreibung und Bewertung i
- Seite 564 und 565:
5.13.2.3 Passivhaus-Holz-Alu-Fenste
- Seite 566 und 567:
5.13.2.5 Kunststofffenster Charakte
- Seite 568 und 569:
5.13.2.7 Holzfenster mit Bestandsra
- Seite 570 und 571:
kg CO2e/m² 100a MJ/m² 100a 300 25
- Seite 572 und 573:
eingebauten Zustand (Uw,eff
- Seite 574 und 575:
Folgende Bestandteile von Fenstern
- Seite 576 und 577:
6 Komfortlüftung 6.1 Vorbemerkunge
- Seite 578 und 579:
Abb. 122: Einsatzschemata in der ko
- Seite 580 und 581:
Die Verteilung der Lüftungsleitung
- Seite 582 und 583:
6.5 Auswahlkriterien Bei der Sanier
- Seite 584 und 585:
Schall Schallpegel, Schalldäm- mun
- Seite 586 und 587:
Abb. 125: Lüftungssystem dezentral
- Seite 588 und 589:
Abb. 127: Lüftungssystem dezentral
- Seite 590 und 591:
7 Schadstoffe in bestehenden Gebäu
- Seite 592 und 593:
7.2 Schadstofferkundung im Altbau D
- Seite 594 und 595:
Schadstoff Polychlorierte Biphenyle
- Seite 596 und 597:
Der Schadstofferkundungsbericht ist
- Seite 598 und 599:
TVOC-Wert Bewertung < 300 µg/m³ H
- Seite 600 und 601:
2. Atemwegs-, Augen- und Hautreizun
- Seite 602 und 603:
wie andere zellulosehaltiges Materi
- Seite 604 und 605:
7.5.3 Identifizierung holzzerstöre
- Seite 606 und 607:
7.6 Relevante Regelwerke und weiter
- Seite 608 und 609:
7.6.6 Holzschutz im Hochbau 35. ÖN
- Seite 610 und 611:
8.1.4 Borsäure Borsäure wird zusa
- Seite 612 und 613:
HBCDD konnte ebenfalls in der Mutte
- Seite 614 und 615:
nicht beeinträchtigt wird. MAK-Wer
- Seite 616 und 617:
1488/94 der Kommission, der Richtli
- Seite 618 und 619:
Eine einheitliche Definition gibt e
- Seite 620 und 621:
Die Verwertbarkeit einer konkreten
- Seite 622 und 623:
§� während der Nutzungsdauer zu
- Seite 624 und 625:
Durch die detailgenaue Darstellung
- Seite 626 und 627:
13 Literaturverzeichnis [Adensam 20
- Seite 628 und 629:
[Bucar 2004] Bucar, G.; Baumgartner
- Seite 630 und 631:
[Feist 2003c] Feist, W. (Hg.): Prot
- Seite 632 und 633:
[Hofer 2006] Hofer, G. et al.: Ganz
- Seite 634 und 635:
ten bei Geschoßwohnbauten der fün
- Seite 636 und 637:
[Plöderl 2006] Plöderl, H.; Berge
- Seite 638 und 639:
[Schweizer 2006] Schweizer, P.: Mod
- Seite 640 und 641:
14 Anhang 14.1 Verwendete Abkürzun
- Seite 642 und 643:
Abb. 133: Jahresverlauf der relativ
- Seite 644:
14.3.3 Lehmboden Abb. 140: Feuchtes