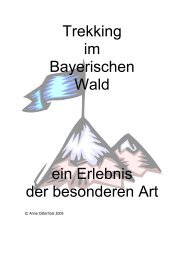- Seite 1 und 2:
Martinschule Rietberg-Verl Schulpro
- Seite 3 und 4:
2.3 Schulsozialarbeit .............
- Seite 5 und 6:
2.17.1.1 Aus einer Arbeitsgemeinsch
- Seite 7 und 8:
2.22.2 Erster Vorschlag ...........
- Seite 9 und 10:
2.34.1 Individualisierung als allge
- Seite 11 und 12:
4.1 Die Schulstation der Martinschu
- Seite 13 und 14:
4.9.3 Das Fach Englisch in der Schu
- Seite 15 und 16:
7.2.5.1 Schulleitung ..............
- Seite 17 und 18:
Anzahl der Schüler mit Zuwanderung
- Seite 19 und 20:
Anbauten / Umbauten in den Jahren
- Seite 21 und 22:
2.1.2.1 Entfaltung der Persönlichk
- Seite 23 und 24:
Der von Rogers auf Eltern bezogenen
- Seite 25 und 26:
Regelverletzungen, die sozial-kommu
- Seite 27 und 28:
Schulordnung mit allgemeinen Schulr
- Seite 29 und 30:
lösungsorientiertes Beratungskonze
- Seite 31 und 32:
Dokumentation: Die Ziele und die Se
- Seite 33 und 34:
die Ermahnung Gruppengespräche mi
- Seite 35 und 36:
Zahlreiche positive Rückmeldungen
- Seite 37 und 38:
Krisenmanagement /sofortige und eng
- Seite 39 und 40:
Nach dem Einstieg ins Gespräch, we
- Seite 41 und 42:
Einstieg gestalten: Es ist wichtig
- Seite 43 und 44:
In der Beratung bei Erziehungs- und
- Seite 45 und 46:
Einzelarbeit mit Schülern zur verl
- Seite 47 und 48:
2.5.1 Schulgarten Der Schulgarten k
- Seite 49 und 50:
2.5.3 „Rund um die (Kopf-)Weide
- Seite 51 und 52:
Mehlschwalben lassen sich gut zähl
- Seite 53 und 54:
Der Spielplatz wurde im Herbst 2003
- Seite 55 und 56:
Kompetenzen und Konzepte des Jugend
- Seite 57 und 58:
Personelle Ausstattung Ein Sozialp
- Seite 59 und 60:
zichtet, damit an jedem Tag mit Hau
- Seite 61 und 62:
Art gibt es viele Sachbücher. Them
- Seite 63 und 64:
o die Schülerfirmen der Martinschu
- Seite 65 und 66:
Ausgangspunkte für die ersten Übe
- Seite 67 und 68:
onen erwerben. Schon aus diesem Gru
- Seite 69 und 70:
Auf dem Hintergrund der oben beschr
- Seite 71 und 72:
Wenn ich die unterschriebenen Benac
- Seite 73 und 74:
Die Erfahrung zeigt: Jugendliche k
- Seite 75 und 76:
2.14.6.2. Einzelgespräche mit den
- Seite 77 und 78:
Die Zusammenarbeit zwischen Busfahr
- Seite 79 und 80:
2.14.10 Daten und Fakten Schuljahr
- Seite 81 und 82:
Ein Fahrzeugbegleiter war seinen Au
- Seite 83 und 84:
2.16.3 Qualifikation der Lehrperson
- Seite 85 und 86:
von Hard- und Softwareproblemen sow
- Seite 87 und 88:
und Lernwerkstatt Sek I) eingesetzt
- Seite 89 und 90:
Diese noch sehr allgemein gehaltene
- Seite 91 und 92:
Diese noch sehr allgemein gehaltene
- Seite 93 und 94:
Mainboards passgenau ins Gehäuse e
- Seite 95 und 96:
Nachdem schon bereits seit den 90er
- Seite 97 und 98:
Haus- und ernährungswissenschaftli
- Seite 99 und 100:
ne Finanzplanung und entwickelt Hil
- Seite 101 und 102:
Bei der Mitarbeit in der Schülerfi
- Seite 103 und 104:
2.17.3.3 Firmenstruktur Das primär
- Seite 105 und 106:
der Verkauf der Bühnenbilder an In
- Seite 107 und 108:
mit einem Partner an einem Bild arb
- Seite 109 und 110:
diesem Wege gelte der Dank all den
- Seite 111 und 112:
Fahrradtechnik Besonderheiten des S
- Seite 113 und 114:
- Waben in einen Kasten setzen und
- Seite 115 und 116:
durch Figur-Grund-Wahrnehmungen (z.
- Seite 117 und 118:
Das schuleigene Netzwerk: Der c´t-
- Seite 119 und 120:
Leseförderung mit „Antolin“ Mi
- Seite 121 und 122:
Die Nachrichten werden von einer Sc
- Seite 123 und 124:
Einmal pro Vierteljahr wird die kom
- Seite 125 und 126:
auf bestimmte Zeit für genau diese
- Seite 127 und 128:
Die sensiblen Schülerdaten werden
- Seite 129 und 130:
Es steht außer Diskussion, dass be
- Seite 131 und 132:
2.18.8.1 Evaluation des digitalen S
- Seite 133 und 134:
In der ersten Konferenz des Schulja
- Seite 135 und 136:
Die Veröffentlichung von Lehrerfot
- Seite 137 und 138:
2.20.3 Diagnose von Sprachkenntniss
- Seite 139 und 140:
tern hinzu. So soll den Migrantenki
- Seite 141 und 142:
Quelle: Liebertz, Charmaine: Das Sc
- Seite 143 und 144:
3 Wochenstunden 9 - 10 3 Wochenstun
- Seite 145 und 146:
2.22.5 Aktualisierung September 201
- Seite 147 und 148:
Im Rahmen der Drehphase des Projekt
- Seite 149 und 150:
die Weiterentwicklung der Kompetenz
- Seite 151 und 152:
Außerdem wenden die Schüler diese
- Seite 153 und 154:
Geeignete Schüler erlernen, wie ma
- Seite 155 und 156:
2.25.6.1 Kurzbeschreibung Der Baust
- Seite 157 und 158:
Vorbereitung, Durchführung und Nac
- Seite 159 und 160:
gleitung endet ein halbes Jahr nach
- Seite 161 und 162:
Vorbereitung auf Vorstellungsgespr
- Seite 163 und 164:
wichtige Ergänzung zu den „hause
- Seite 165 und 166:
Eine angestrebte lokale Verortung d
- Seite 167 und 168:
2.26.4.2 Externe Evaluation Da es s
- Seite 169 und 170:
Fortbildung bedarfsgerecht und eige
- Seite 171 und 172:
2.27.4.3 Angebote der Unfallkasse N
- Seite 173 und 174:
2.27.8 Regelung für Pädagogische
- Seite 175 und 176:
Termin: Februar 2012, Moderation: S
- Seite 177 und 178:
wichtiges Element in dieser Feier.
- Seite 179 und 180:
ReLv basiert auf den Strategien nac
- Seite 181 und 182:
Für Rechtschreiblernen gilt wie f
- Seite 183 und 184:
von Mehrfachbehinderungen, ein erh
- Seite 185 und 186:
Die Stufenteams tragen die Ergebnis
- Seite 187 und 188:
(4) Die Fachkonferenz entscheidet i
- Seite 189 und 190:
positiv hervorzuheben, da sie im Be
- Seite 191 und 192:
ein vorgefertigtes Formular zur Ver
- Seite 193 und 194:
Die Freude, der Erfolg am eigenen T
- Seite 195 und 196:
Aufgreifen bedeutsamer Fragestellun
- Seite 197 und 198:
Die nun folgenden Punkte beschreibe
- Seite 199 und 200:
In der Unterstufe sollten diese Inh
- Seite 201 und 202:
3.2.6.3 zeitliche Orientierung Sch
- Seite 203 und 204:
Seit 1995 steht in der Martinschule
- Seite 205 und 206:
higkeit und Reaktionsvermögen zu f
- Seite 207 und 208:
Ein breites Feld von ästhetischen
- Seite 209 und 210:
3.2.16.2 Sprachförderunterricht Hi
- Seite 211 und 212:
Geometrie: senkrecht, waagerecht,
- Seite 213 und 214:
Klasse 5 Erlesen von umfangreicher
- Seite 215 und 216:
Jungsteinzeit ( Sesshaftwerdung, Ha
- Seite 217 und 218:
Verkehrswege/ Transportwege Landsch
- Seite 219 und 220:
3.3.7 Religion In der Mittelstufe w
- Seite 221 und 222:
Thematische Schwerpunkte Jahrgang 7
- Seite 223 und 224:
ieten ausreichend Beispiele für di
- Seite 225 und 226:
Addition und Subtraktion mit gleich
- Seite 227 und 228:
Länder/Insel-Umrisse einprägen m
- Seite 229 und 230:
der Ernährungskreis Wege der gesu
- Seite 231 und 232:
In geschlechtsgetrennten Gruppen :
- Seite 233 und 234:
Metallberufe Metalle mit ihren beso
- Seite 235 und 236:
3.4.1.8 Hauswirtschaft Besondere Ei
- Seite 237 und 238:
treiben angebahnt werden. Aufgrund
- Seite 239 und 240:
während der Veranstaltung sind die
- Seite 241 und 242:
Rechtecke und Quadrate (auch Netzze
- Seite 243 und 244:
Textproduktion Musterformulare Lebe
- Seite 245 und 246:
gungsmaßnahmen und Heilungsmethode
- Seite 247 und 248:
Grundkenntnisse über die Entstehun
- Seite 249 und 250:
Aufgrund anderweitiger bzw. vordrin
- Seite 251 und 252:
Stromerzeugung in diversen Kraftwer
- Seite 253 und 254:
Waschen von Kleidung: Sortieren der
- Seite 255 und 256:
„Einkaufen will gelernt sein“ -
- Seite 257 und 258:
Die Teamarbeit ist eine weitere Lei
- Seite 259 und 260:
Schulprogramm Martinschule Seite 25
- Seite 261 und 262:
Anlage 3 Selbsteinschätzung zum Ze
- Seite 263 und 264:
4. Schulstation 4.1 Die Schulstatio
- Seite 265 und 266: die Umschulung in das jeweils angem
- Seite 267 und 268: Nach der Prüfung des Pädagogische
- Seite 269 und 270: 4.1.6 Schulstation und Inklusionsbe
- Seite 271 und 272: nen der Schulstation die „Ankerpu
- Seite 273 und 274: Die für das Schuljahr 2010/11 gepl
- Seite 275 und 276: Erarbeitung einer Vertrauens- und B
- Seite 277 und 278: Sich im angemessenen Tempo bewegen
- Seite 279 und 280: Ich muss zuerst nachsehen, ob die B
- Seite 281 und 282: aus Edelstahl sein, damit sie nicht
- Seite 283 und 284: Begrenzung des Raumes / des Bewegun
- Seite 285 und 286: Holzzapfen hergestellt für das Bet
- Seite 287 und 288: Kompetenzen und Aufgabenfelder 4.2.
- Seite 289 und 290: 4.2.3 Konzept des Erziehungsprozess
- Seite 291 und 292: der Klassenleitung der aufnehmenden
- Seite 293 und 294: Stichpunkte: Wie können Stärken u
- Seite 295 und 296: 3. Arbeitshaltung 3. 1 hat Arbeitsm
- Seite 297 und 298: 10. grafische Darstellungen 10.1 K
- Seite 299 und 300: Name:_______________________Beobach
- Seite 301 und 302: 6. 3 kann in einer Gruppe konstrukt
- Seite 303 und 304: 4.3.4.2 Beobachtungsbogen „Differ
- Seite 305 und 306: gerer motivierter Regelschüler am
- Seite 307 und 308: 20. Konfliktlösungsstrategien gut
- Seite 309 und 310: „Psychische oder tiefgreifende Ve
- Seite 311 und 312: gemeinsames Fußballtraining am Nac
- Seite 313 und 314: Jeweils ein Sonderpädagoge und ein
- Seite 315: Erziehungsabsprachen Betreuung von
- Seite 319 und 320: 4.5.5 Individualisierung in der Sch
- Seite 321 und 322: Schüler mit in das Schulleben einb
- Seite 323 und 324: Übungen zu einzelnen Unterrichtsin
- Seite 325 und 326: Geometrie: „Punkte übertragen“
- Seite 327 und 328: e für die Schulstation geeignet wa
- Seite 329 und 330: gliederung von Mitschülern (Suppor
- Seite 331 und 332: tigend wirken (z.B. hoher Lärmpege
- Seite 333 und 334: Spalte bei Bedarf größer 4.7.4 Fo
- Seite 335 und 336: den, z. B. hinsichtlich einer mange
- Seite 337 und 338: Ich bekomme Hilfe beim Lernen. Hie
- Seite 339 und 340: Umgang mit einem Messer o verschied
- Seite 341 und 342: Körperkontakt zu einem Erwachsenen
- Seite 343 und 344: o Ich ziehe am nächsten Tag sauber
- Seite 345 und 346: Tierquälerei (Entenküken) o Veran
- Seite 347 und 348: zur Heimleitung in das Sekretariat
- Seite 349 und 350: Hausaufgabenkontrolle o Unterrichts
- Seite 351 und 352: 6. Ich bleibe im Internet nur in de
- Seite 353 und 354: o heute, morgen, gestern, übermorg
- Seite 355 und 356: Gestaltung von Bühnenbildern stell
- Seite 357 und 358: Name: ____________________ Wo stehe
- Seite 359 und 360: 4.10.3 Mitbestimmung bei der Entwic
- Seite 361 und 362: deren künstlerische Gestaltung“
- Seite 363 und 364: die räumliche Distanz (das gesamte
- Seite 365 und 366: mit der Klinikschule der Kinder- un
- Seite 367 und 368:
vordringlich: weitere Konkretisieru
- Seite 369 und 370:
positive Ansätze, Ressourcen: Tis
- Seite 371 und 372:
gen werden. Die Erfahrung zeigt bis
- Seite 373 und 374:
5.3 Brandschutz und Verhalten bei F
- Seite 375 und 376:
Fachraum Hauswirtschaft Frau Uta Ru
- Seite 377 und 378:
cherten Tätigkeit eingetreten ist.
- Seite 379 und 380:
10. Die Schulleitung und die Lehrkr
- Seite 381 und 382:
Lufthygiene : Nach jeder Schulstund
- Seite 383 und 384:
In den Lehr- und Übungsräumen sin
- Seite 385 und 386:
5.6.3 Holzstaub in der Luft Zu den
- Seite 387 und 388:
5.10 Betriebsanweisung für den Umg
- Seite 389 und 390:
Die entsprechenden Kennzeichen kön
- Seite 391 und 392:
5.13 Notfallkonzept der Martinschul
- Seite 393 und 394:
Schulprogramm Martinschule Seite 39
- Seite 395 und 396:
Schulprogramm Martinschule Seite 39
- Seite 397 und 398:
Anhang 2 Schulwanderungen und Schul
- Seite 399 und 400:
und der Gegenstände des Unterricht
- Seite 401 und 402:
Schulprogramm Martinschule Seite 40
- Seite 403 und 404:
6.3 Vereinbarungen zum Wechsel oder
- Seite 405 und 406:
ichts/Untersuchungen/Tests. Protoko
- Seite 407 und 408:
Die in diesem Abschnitt zusammengef
- Seite 409 und 410:
obachtungen und Beratungen ist frü
- Seite 411 und 412:
Nähe - Distanz (kann körperliche
- Seite 413 und 414:
Zeugnisarbeit, Förderplanarbeit,
- Seite 415 und 416:
Teilnahme an Teamsitzungen (mit Lei
- Seite 417 und 418:
7.2.5.2 Kollegium In der Anfangsph
- Seite 419 und 420:
Im Einzelnen wurden folgende Wünsc
- Seite 421 und 422:
gestellten Aufgaben möglich sein w
- Seite 423 und 424:
26. 2 x im Jahr gemeinsamer Gartent
- Seite 425 und 426:
8.3 Ergebnisse der Befragung, Auswe
- Seite 427 und 428:
Item Nr. ++ + 0 - -- Weiterarbeit g
- Seite 429 und 430:
8.3.1 Auswertung und Interpretation
- Seite 431:
Eine Evaluation hat rückblickend d