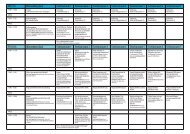MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
218 Das Potenzial der weiblichen Arbeiterklasse<br />
Ideen bemerkbar. Oft hatten sich Frauengruppen neu gegründet. Durch Quotenregelungen<br />
begannen Frauen seit den 1980er Jahren in gewerkschaftlichen<br />
Gremien eine stärkere Repräsentanz zu erhalten. Doch in den gewerkschaftlichen<br />
Auseinandersetzungen, die meist Abwehrkämpfe in männlich dominierten<br />
Branchen waren, spielten sie weiter oft nur eine geringe Rolle. Eine bedeutsame<br />
Ausnahme bildete der zehnwöchige Streik der Westberliner Erzieherinnen<br />
1989/90 für einen Mindestpersonalschlüssel und eine Aufwertung des Erzieherberufes.<br />
Es war einer der längsten Arbeitskämpfe in der Nachkriegsgeschichte. 77<br />
Die Grenzen der weiblichen Erwerbstätigkeit in der DDR<br />
Die Frauenerwerbstätigkeit im östlichen Teil Deutschlands, der Deutschen Demokratischen<br />
Republik (DDR), griff deutlich weiter aus als in Westdeutschland,<br />
war aber dennoch von einer Gleichstellung weit entfernt. Am deutlichsten wurde<br />
dies mit Blick auf die führende Riege der herrschenden Partei, die vierzig Jahre<br />
lang fast ausschließlich aus Männern bestand. Aber auch die großen Industriekomplexe,<br />
die sogenannten Kombinate, wurden in aller Regel von Männern geführt.<br />
Die Machthaber der Staatspartei SED gaben vor, im Namen der Arbeiterklasse<br />
zu regieren. Tatsächlich benutzten sie jedoch nur sozialistische Floskeln, um ihre<br />
Herrschaft ideologisch zu rechtfertigen. In der DDR gab es weder freie Gewerkschaften<br />
noch ein Streikrecht, geschweige denn Arbeitermacht. 78<br />
Die weibliche Erwerbstätigkeit entwickelte sich in der DDR rasant. In den späten<br />
1970er Jahren überstieg die Erwerbsquote der Frauen mit 78,0 % erstmals<br />
die der Männer mit 77,7 % und verblieb seitdem auf einem deutlich höheren Niveau.<br />
1950 hatte die weibliche Erwerbsquote noch bei 44,1 % gelegen, 1960 bei<br />
61,9 %. 79 Der Hintergrund war ein Arbeitskräftemangel, denn bis zum Mauerbau<br />
1961 verließen über zwei Millionen Menschen die DDR. So war das System gezwungen,<br />
die Frauen fast vollständig in den Arbeitsprozess einzubeziehen. Um<br />
77<br />
Der Streik stand in Konfrontation zum damaligen rot-grünen Senat in Berlin und verhärtete sich<br />
zunehmend. Er endete in einer Niederlage. Die Gewerkschaftsführungen von ÖTV und GEW<br />
setzten den Streik nach zehn Wochen aus, obwohl die Stimmung für eine Fortsetzung stand. In<br />
der neunten Woche hatten in einer geheimen Abstimmung in Neukölln von 500 Erzieherinnen<br />
nur 15 für einen Abbruch des Streiks gestimmt. (Tagesspiegel 15.04.2002 »Am meisten litten die<br />
Eltern«). Dennoch war der Streik ein Achtungszeichen.<br />
78<br />
Die DDR als auch die anderen Ostblockstaaten lassen sich als staatskapitalistisch bezeichnen.<br />
Die kleine Führungsgruppe einer Staatspartei kontrollierte die nationale Wirtschaft, die im Weltkapitalismus<br />
in Konkurrenz zur den westlichen Ländern stand. Der Staatskapitalismus war eine<br />
historisch besondere Erscheinung, der in späten 1920er/frühen 1930er Jahren aus dem Scheitern<br />
der vormals erfolgreichen russischen Revolution 1917 entstand, vgl. Tony Cliff – Staatskapitalismus<br />
in Rußland, Sozialistische Arbeitergruppe Frankfurt 1975.<br />
79<br />
Klenke, Olaf: Kampfauftrag Mikrochip: Rationalisierung und sozialer Konflikt im »Staatssozialismus«<br />
der DDR, Hamburg 2008, S. 106.