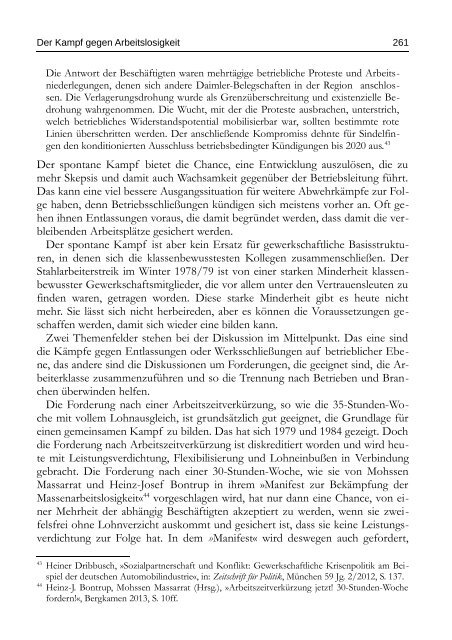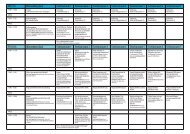MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit 261<br />
Die Antwort der Beschäftigten waren mehrtägige betriebliche Proteste und Arbeitsniederlegungen,<br />
denen sich andere Daimler-Belegschaften in der Region anschlossen.<br />
Die Verlagerungsdrohung wurde als Grenzüberschreitung und existenzielle Bedrohung<br />
wahrgenommen. Die Wucht, mit der die Proteste ausbrachen, unterstrich,<br />
welch betriebliches Widerstandspotential mobilisierbar war, sollten bestimmte rote<br />
Linien überschritten werden. Der anschließende Kompromiss dehnte für Sindelfingen<br />
den konditionierten Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2020 aus. 43<br />
Der spontane Kampf bietet die Chance, eine Entwicklung auszulösen, die zu<br />
mehr Skepsis und damit auch Wachsamkeit gegenüber der Betriebsleitung führt.<br />
Das kann eine viel bessere Ausgangssituation für weitere Abwehrkämpfe zur Folge<br />
haben, denn Betriebsschließungen kündigen sich meistens vorher an. Oft gehen<br />
ihnen Entlassungen voraus, die damit begründet werden, dass damit die verbleibenden<br />
Arbeitsplätze gesichert werden.<br />
Der spontane Kampf ist aber kein Ersatz für gewerkschaftliche Basisstrukturen,<br />
in denen sich die klassenbewusstesten Kollegen zusammenschließen. Der<br />
Stahlarbeiterstreik im Winter 1978/79 ist von einer starken Minderheit klassenbewusster<br />
Gewerkschaftsmitglieder, die vor allem unter den Vertrauensleuten zu<br />
finden waren, getragen worden. Diese starke Minderheit gibt es heute nicht<br />
mehr. Sie lässt sich nicht herbeireden, aber es können die Voraussetzungen geschaffen<br />
werden, damit sich wieder eine bilden kann.<br />
Zwei Themenfelder stehen bei der Diskussion im Mittelpunkt. Das eine sind<br />
die Kämpfe gegen Entlassungen oder Werksschließungen auf betrieblicher Ebene,<br />
das andere sind die Diskussionen um Forderungen, die geeignet sind, die Arbeiterklasse<br />
zusammenzuführen und so die Trennung nach Betrieben und Branchen<br />
überwinden helfen.<br />
Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, so wie die 35-Stunden-Woche<br />
mit vollem Lohnausgleich, ist grundsätzlich gut geeignet, die Grundlage für<br />
einen gemeinsamen Kampf zu bilden. Das hat sich 1979 und 1984 gezeigt. Doch<br />
die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ist diskreditiert worden und wird heute<br />
mit Leistungsverdichtung, Flexibilisierung und Lohneinbußen in Verbindung<br />
gebracht. Die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche, wie sie von Mohssen<br />
Massarrat und Heinz-Josef Bontrup in ihrem »Manifest zur Bekämpfung der<br />
Massenarbeitslosigkeit« 44 vorgeschlagen wird, hat nur dann eine Chance, von einer<br />
Mehrheit der abhängig Beschäftigten akzeptiert zu werden, wenn sie zweifelsfrei<br />
ohne Lohnverzicht auskommt und gesichert ist, dass sie keine Leistungsverdichtung<br />
zur Folge hat. In dem »Manifest« wird deswegen auch gefordert,<br />
43<br />
Heiner Dribbusch, »Sozialpartnerschaft und Konflikt: Gewerkschaftliche Krisenpolitik am Beispiel<br />
der deutschen Automobilindustrie«, in: Zeitschrift für Politik, München 59 Jg. 2/2012, S. 137.<br />
44<br />
Heinz-J. Bontrup, Mohssen Massarrat (Hrsg.), »Arbeitszeitverkürzung jetzt! 30-Stunden-Woche<br />
fordern!«, Bergkamen <strong>2013</strong>, S. 10ff.