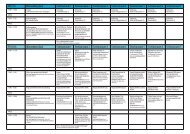MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
MARXISMUS & GEWERKSCHAFTEN - MARX IS MUSS 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit 247<br />
und/oder frühzeitige Beendigung der Erwerbstätigkeit;<br />
– Verminderung der individuellen Jahresarbeitszeit.« 14<br />
An erster Stelle stand hier beschämender Weise die Forderung nach einer Verringerung<br />
der Zahl der Arbeitsimmigranten, gefolgt von Vorschlägen zur Arbeitszeitreduzierung,<br />
die mit Lohnverzicht verbunden waren. Dieser Mix aus verschiedenen<br />
Forderungen und die Diskussion darum waren eher dazu geeignet,<br />
die Gewerkschaftsbewegung zu spalten und zu schwächen, als eine überzeugende<br />
Perspektive im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu bieten.<br />
Es gab zu diesem Zeitpunkt in der Debatte um die Perspektiven der Gewerkschaftsbewegung<br />
im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit aber auch eine<br />
starke Strömung, die ihre Wurzeln in den Streikbewegungen 1969 bis 1973 hatte.<br />
Vor allem 1973 war es zu einer deutlichen Entfremdung zwischen der Führung<br />
und Teilen der Basis gekommen, die ihre Interessenvertretung in die eigene<br />
Hand nahm, weil die Führung Lohnabschlüsse vereinbart hatte, die weit hinter<br />
der Gewinnentwicklung zurückblieben. Die Arbeitslosigkeit spielte zu diesem<br />
Zeitpunkt keine Rolle und fiel damit als Disziplinierungsmittel aus.<br />
Die Streikbewegung 1973 begann in der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie.<br />
In mehreren Wellen über fast ein Jahr verteilt beteiligten sich damals rund<br />
275.000 Arbeiter aus mindestens 335 Betrieben an den Streiks. 15 Nur zwei Jahre<br />
später hatten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen mit der tiefen Krise<br />
1974/75 dramatisch verschlechtert. Die einfachen Mitglieder in den Betrieben<br />
fürchteten entweder um ihren Arbeitsplatz oder sahen sich damit konfrontiert,<br />
dass die Arbeitgeber die Situation ausnutzten, um die Löhne zu drücken. Die<br />
Folge war zunächst eine Verunsicherung an der Basis in den Betrieben, weil es<br />
zunächst keine überzeugende Antwort durch die Gewerkschaften auf die steigende<br />
Arbeitslosigkeit gab.<br />
Der Leidensdruck infolge der Arbeitslosigkeit ist in der Stahlindustrie besonders<br />
groß gewesen, weil es hier früher als in anderen Branchen bereits Anfang<br />
der 1970er Jahre Massenentlassungen gab. 16 Die Vertrauensleute, Betriebsräte<br />
und Gewerkschaftssekretäre waren hier besonders hart mit der Frage konfrontiert,<br />
wie sich die Gewerkschaftsbewegung eine Antwort auf die steigende Arbeitslosigkeit<br />
vorstellt.<br />
14<br />
H. Seifert, Referent beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) des DGB,<br />
»Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt 1975«, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1/76, S. 8.<br />
15<br />
Redaktionskollektiv express, »Spontane Streiks 1973 – Krise der Gewerkschaftspolitik«, Offenbach<br />
1974, S. 22ff.<br />
16<br />
Ähnlich prekär war die Lage in der Druckindustrie, weil Rationalisierungen, forciert durch technische<br />
Entwicklungen, die Stellung vieler Facharbeiter entwertete. Die Drucker haben deswegen<br />
1976 und 1978 zunächst versucht, Rationalisierungsschutzabkommen durchzusetzen, was misslang.<br />
Erst danach haben sie die Forderung nach der 35-Stunden-Woche erhoben.