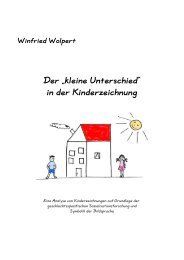- Seite 1 und 2:
Als Dissertationsschrift eingereich
- Seite 3:
3 1. Berichterstatter: Prof. Dr. An
- Seite 6 und 7:
2 5. Weiterführung oder Gegenmodel
- Seite 8 und 9:
4 Vorwort Die Anfänge dieser Arbei
- Seite 10 und 11:
6 Auch von Seiten der Politik wurde
- Seite 12 und 13:
8 unterworfen war, lediglich unter
- Seite 14 und 15:
10 2. Forschungslage Angesichts der
- Seite 16 und 17:
12 Im Zuge des aktuellen Interesses
- Seite 18 und 19:
14 zichtet. 27 Fortan galt die Zeit
- Seite 20 und 21:
16 Das Archiv der HfG in Ulm verfol
- Seite 22 und 23:
18 3. Schwerpunkte der theoretische
- Seite 24 und 25:
20 sprechend galten die einzelnen P
- Seite 26 und 27:
22 ü bergreifendes System zu benen
- Seite 28 und 29:
24 Damit wurde das Bauhaus zum Resu
- Seite 30 und 31:
26 Die deutsche Presse registrierte
- Seite 32 und 33:
28 Die in dieser Atmosphäre entwor
- Seite 34 und 35:
30 zugewiesene besondere Bedeutung
- Seite 36 und 37:
32 3.3.2. Instrumentalisierung des
- Seite 38 und 39:
34 In der Presse wurde das arg heru
- Seite 40 und 41:
36 Gropius’ vielfach beschworene
- Seite 42 und 43:
38 dete sich auch Gropius selbst zu
- Seite 44 und 45:
40 Gegenteil durch eigene Publikati
- Seite 46 und 47:
42 eine Schar von „Abtrü nnigen
- Seite 48 und 49:
44 Gelegenheit geboten, sein persö
- Seite 50 und 51:
46 die am Bauhaus geschaffenen Gege
- Seite 52 und 53:
48 4. Institutionalisiertes Gedä c
- Seite 54 und 55:
50 work and that he functions well
- Seite 56 und 57:
52 unterworfen habe. 165 Damit hatt
- Seite 58 und 59:
54 4.2.1.1. Darstellung der Wurzeln
- Seite 60 und 61:
56 habe er die einflußreiche Weima
- Seite 62 und 63:
58 Ideologie mit Erkenntnis und pro
- Seite 64 und 65:
60 In Reaktion auf die verschiedene
- Seite 66 und 67:
62 Behandlung der Negative, bei der
- Seite 68 und 69:
64 am Stü tzpfeiler durch den Raum
- Seite 70 und 71:
66 blieb die Hoffnung, mit der Mono
- Seite 72 und 73:
68 Gropius intensiv in seinem Brief
- Seite 74 und 75:
70 Trotz aller, angesichts der imme
- Seite 76 und 77:
72 „Als Sitz des Archives erschie
- Seite 78 und 79:
74 ist, und daßer also gewisserma
- Seite 80 und 81:
76 fen. 237 Andere Stimmen gingen s
- Seite 82 und 83:
78 gen vorbehalten blieben, und in
- Seite 84 und 85:
80 Die im Bauhaus entstandenen Entw
- Seite 86 und 87:
82 ebensowenig wie gestaltungs- ode
- Seite 88 und 89:
84 Adler schließlich referierte im
- Seite 90 und 91:
86 ermöglichte Wingler dieses Proj
- Seite 92 und 93:
88 mit seinem Artikel Ist das Bauha
- Seite 94 und 95:
90 4.3.3. Das neue Archiv-Gebä ude
- Seite 96 und 97:
92 aber wohl auch wegen mangelnden
- Seite 98 und 99:
94 vervollständigten zwar den theo
- Seite 100 und 101:
96 und auch finanziellen Unterstü
- Seite 102 und 103:
98 5. Weiterführung oder Gegenmode
- Seite 104 und 105:
100 hätten Verrat an der Grü ndun
- Seite 106 und 107:
102 5.1. Richtungsweisende Bauhä u
- Seite 108 und 109:
104 richtete Schule entschieden hä
- Seite 110 und 111:
106 fü hrung fast vollständig in
- Seite 112 und 113:
108 ßerordentlich wirkungsvoll“
- Seite 114 und 115:
110 nachvollziehen, da er die Manip
- Seite 116 und 117:
112 darauf schließen, daßBill sic
- Seite 118 und 119:
114 Lehre aber durch all diese Ver
- Seite 120 und 121:
116 schule. Er wäre „ein schlech
- Seite 122 und 123:
118 che Größe. Die erwarte ich vo
- Seite 124 und 125:
120 formen, indem er Gropius geziel
- Seite 126 und 127:
122 Nachkriegszeit. 376 Von der Ank
- Seite 128 und 129:
124 verbreitete Bill nicht nur juge
- Seite 130 und 131:
126 einzugehen und sein Verständni
- Seite 132 und 133:
128 teure, die die Zusammenhänge,
- Seite 134 und 135:
130 Augen eines Fachpublikums, als
- Seite 136 und 137:
132 relle Klima in der Bundesrepubl
- Seite 138 und 139:
134 deutschen Hochschullandschaft s
- Seite 140 und 141:
136 die Ulmer Veranstaltung ledigli
- Seite 142 und 143:
138 Zeit in Ulm zu verschwenden, we
- Seite 144 und 145:
140 die in der Nachkriegszeit in Be
- Seite 146 und 147:
142 Vorträge von Gropius wertete e
- Seite 148 und 149:
144 tert, so daßnun in der Art der
- Seite 150 und 151:
146 Bild der Ulmer Hochschule nach
- Seite 152 und 153:
148 gleich hinaus ging die Autorin
- Seite 154 und 155:
150 alspende den Ausschlag dafü r,
- Seite 156 und 157:
152 die einzelnen Werkstätten bei
- Seite 158 und 159:
154 gelpunkt der Verwaltungstrakt a
- Seite 160 und 161:
156 schiedlichen Blickwinkel fü ge
- Seite 162 und 163:
158 Mensa-Bereich hat. Verglichen m
- Seite 164 und 165:
160 rü cksichtigt ließ, sich soga
- Seite 166 und 167:
162 gentliche plastik, liegt nicht
- Seite 168 und 169:
164 weit ins Donautal und an klaren
- Seite 170 und 171:
166 Selbstverständlichkeit dar. In
- Seite 172 und 173:
168 auch dessen Beurteilung sollte
- Seite 174 und 175:
170 das Aufgabengebiet der Industri
- Seite 176 und 177: 172 niemals haben werde, da zu viel
- Seite 178 und 179: 174 Unzufriedenheit der Studierende
- Seite 180 und 181: 176 Nichtsdestotrotz war Peterhans
- Seite 182 und 183: 178 lenlage schwer zu beantworten.
- Seite 184 und 185: 180 konkreten Entwurfs- und Gestalt
- Seite 186 und 187: 182 dik“ und die Werkstattarbeit
- Seite 188 und 189: 184 vermehrte Einrichtung von wisse
- Seite 190 und 191: 186 und ihre speziellen Verarbeitun
- Seite 192 und 193: 188 gen. Häufig waren die Firmen i
- Seite 194 und 195: 190 Dem Dessauer Bauhaus und der Hf
- Seite 196 und 197: 192 Als weiteres Beispiel fü r den
- Seite 198 und 199: 194 dungselement auch optisch die D
- Seite 200 und 201: 196 werden sollten. Auf diese Weise
- Seite 202 und 203: 198 genheiten den damals knapp beme
- Seite 204 und 205: 200 einzelne Subsysteme zu untergli
- Seite 206 und 207: 202 lung als auch ihrer ästhetisch
- Seite 208 und 209: 204 von Klee und Kandinsky zu berü
- Seite 210 und 211: 206 gearbeitet, das heißt, an der
- Seite 212 und 213: 208 Berü cksichtigt man die bis hi
- Seite 214 und 215: 210 teilweisen Zerstörung ihren In
- Seite 216 und 217: 212 Die im Zuge der Untersuchungen
- Seite 218 und 219: 214 seine Rolle als Pädagoge ein.
- Seite 220 und 221: 216 indem er auf weißem Grund 40 %
- Seite 222 und 223: 218 Neben den beschriebenen Ähnlic
- Seite 224 und 225: 220 Ausbildung unter Berü cksichti
- Seite 228 und 229: 224 6. Die Ausstellung 50 jahre bau
- Seite 230 und 231: 226 die Sichtbarmachung der fortwä
- Seite 232 und 233: 228 6.2. Katalog Die Zusammenstellu
- Seite 234 und 235: 230 politischen und ethischen Ansch
- Seite 236 und 237: 232 nur aus Europa, sondern auch au
- Seite 238 und 239: 234 An den Arbeiten Wagenfelds wird
- Seite 240 und 241: 236 leuchten; es weist auch auf die
- Seite 242 und 243: 238 eine solche Hinterfragung der R
- Seite 244 und 245: 240 Bauhaus-Schü ler bis ans Ende
- Seite 246 und 247: 242 waren die meisten der Bauhaus-G
- Seite 248 und 249: 244 „Der Kardinalpunkt der Bauhau
- Seite 250 und 251: 246 auszuwählen und „nur die Mod
- Seite 252 und 253: 248 stellung unabhängig von histor
- Seite 254 und 255: 250 den sechziger Jahren geschehen
- Seite 256 und 257: 252 1962 1963 Organisation: Ausstel
- Seite 258 und 259: 254 Noch 1965 1966 Vorträge: Werne
- Seite 260 und 261: 256 1969 1970 Organisation: Ausstel
- Seite 262 und 263: 258 9.2. Verzeichnisse 9.2.1. Quell
- Seite 264 und 265: 260 Grote, Ludwig: Brief an Walter
- Seite 266 und 267: 262 Archiv der Hochschule für Gest
- Seite 268 und 269: 264 Die Bauhaus-Idee ist so aktuell
- Seite 270 und 271: 266 Brög, Hans / Sauerbier, S.D. /
- Seite 272 und 273: 268 Funke, Hermann: Wer hat Angst v
- Seite 274 und 275: 270 Grote, Ludwig: Die Schule des n
- Seite 276 und 277:
272 Itten, Johannes: Kunst der Farb
- Seite 278 und 279:
274 Lewandowski, Edmund D.: An Idea
- Seite 280 und 281:
276 Nerdinger, Winfried (Hrsg.): Ba
- Seite 282 und 283:
278 Raguhn, Robert: Sowjetzone reha
- Seite 284 und 285:
280 Seckendorff, Eva von: Außer Ba
- Seite 286 und 287:
282 Vom alten Bauhaus zum „ progr
- Seite 288 und 289:
284 9.2.3. Abbildungsverzeichnis Ab
- Seite 290 und 291:
286 Abbildung 25: Abbildung 26: Abb
- Seite 292 und 293:
288 Abbildung 46: Abbildung 47: Abb
- Seite 294 und 295:
290 Abbildung 68: Hans Gugelot: Spi
- Seite 296 und 297:
292 Abbildung 89: Abbildung 90: Abb
- Seite 298 und 299:
294 Abb. 3 Walter Gropius: Bauhausg
- Seite 300 und 301:
296 Abb. 7 Bauhausgebäude Dessau,
- Seite 302 und 303:
298 Abb. 11 Erich Dieckmann: Schrei
- Seite 304 und 305:
300 Abb. 15 Flugblatt der HfG Ulm;
- Seite 306 und 307:
302 Abb. 19 Bauhausgebäude Dessau,
- Seite 308 und 309:
304 Abb. 23 Lucia Moholy: Bauhausge
- Seite 310 und 311:
306 Abb. 26 Ernst Scheidegger: Hoch
- Seite 312 und 313:
308 Abb. 30 Max Bill: Denkmal fü r
- Seite 314 und 315:
310 Abb. 34 Wolfgang Siol: Hochschu
- Seite 316 und 317:
312 Abb. 38 Hochschule fü r Gestal
- Seite 318 und 319:
314 Abb. 42 Paul Klee: Manuskriptbl
- Seite 320 und 321:
316 Abb. 46 Maurice Goldring: Verä
- Seite 322 und 323:
318 Abb. 50 Kerstin Bartlmae, Peter
- Seite 324 und 325:
320 Abb. 54 Immo Krumrey: Unregelm
- Seite 326 und 327:
322 Abb. 58 Walter Zeischegg: Beleu
- Seite 328 und 329:
324 Abb. 62 Hans Gugelot: m 125 als
- Seite 330 und 331:
326 Abb.66 Walter Gropius: Prospekt
- Seite 332 und 333:
328 Abb. 70 Hans (Nick) Roericht: H
- Seite 334 und 335:
330 Abb. 74 Herbert Ohl, Bernd Meur
- Seite 336 und 337:
332 Abb. 78 Friedrich Vordemberge-
- Seite 338 und 339:
334 Abb. 81 Walter Zeischegg: Obsts
- Seite 340 und 341:
336 Abb. 85 François Morellet: Zuf
- Seite 342 und 343:
338 Abb. 89 Peter Hofmeister: Kinde
- Seite 344 und 345:
340 Abb. 93 Hans Gugelot u.a.: Radi
- Seite 347 und 348:
293 Lebenslauf Claudia Heitmann, M.