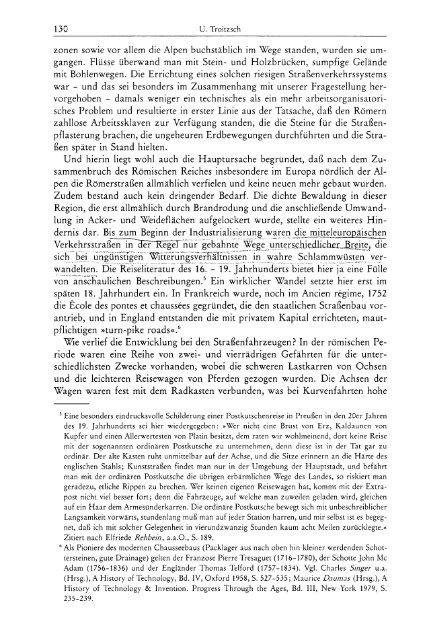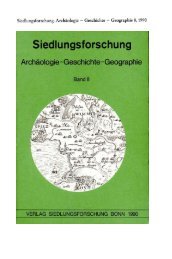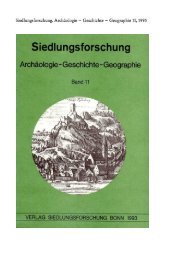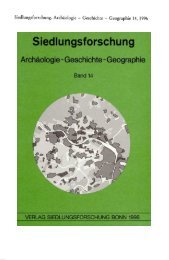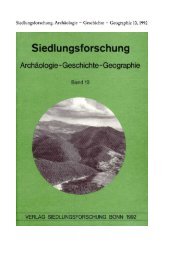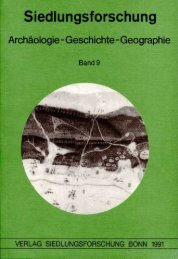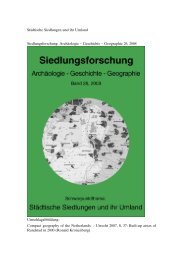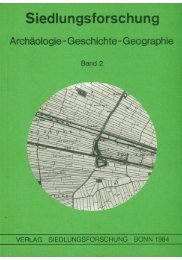Verkehrswege und ihre Bedeutung für die Kulturlandschaft
Verkehrswege und ihre Bedeutung für die Kulturlandschaft
Verkehrswege und ihre Bedeutung für die Kulturlandschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
13 0 U . Troitzsch<br />
zonen sowie vor allem <strong>die</strong> Alpen buchstäblich im Wege standen, wurden sie umgangen<br />
. Flüsse überwand man mit Stein- <strong>und</strong> Holzbrücken, sumpfige Gelände<br />
mit Bohlenwegen . Die Errichtung eines solchen riesigen Straßenverkehrssystems<br />
war - <strong>und</strong> das sei besonders im Zusammenhang mit unserer Fragestellung hervorgehoben<br />
- damals weniger ein technisches als ein mehr arbeitsorganisatorisches<br />
Problem <strong>und</strong> resultierte in erster Linie aus der Tatsache, daß den Römern<br />
zahllose Arbeitssklaven zur Verfügung standen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Steine <strong>für</strong> <strong>die</strong> Straßenpflasterung<br />
brachen, <strong>die</strong> ungeheuren Erdbewegungen durchführten <strong>und</strong> <strong>die</strong> Straßen<br />
später in Stand hielten .<br />
Und hierin liegt wohl auch <strong>die</strong> Hauptursache begründet, daß nach dem Zusammenbruch<br />
des Römischen Reiches insbesondere im Europa nördlich der Alpen<br />
<strong>die</strong> Römerstraßen allmählich verfielen <strong>und</strong> keine neuen mehr gebaut wurden .<br />
Zudem bestand auch kein dringender Bedarf . Die dichte Bewaldung in <strong>die</strong>ser<br />
Region, <strong>die</strong> erst allmählich durch Brandrodung <strong>und</strong> <strong>die</strong> anschließende Umwandlung<br />
in Acker- <strong>und</strong> Weideflächen aufgelockert wurde, stellte ein weiteres Hindernis<br />
dar . Bis zum Beginn der Industrialisierung waren <strong>die</strong> mitteleu ropäischen<br />
Verkehrsstraßen m d-er Segel nur gebahnte Wege, unters k~ie.d.lic het' ,u., reite,~ <strong>die</strong><br />
sich ungünstigen Witterungsverhältnissen in wahre Schlammwüsten verwandelten<br />
. Die Reiseliteratur des 16 . .- 19 . Jahrh<strong>und</strong>erts bietet hier 'a eine Fülle<br />
von anschaulichen Beschreibungen .' Ein wirklicher Wandel setzte hier erst im<br />
späten 18 . Jahrh<strong>und</strong>ert ein . In Frankreich wurde, noch im Ancien regime, 1752<br />
<strong>die</strong> Ecole des pontes et chaussees gegründet, <strong>die</strong> den staatlichen Straßenbau vorantrieb,<br />
<strong>und</strong> in England entstanden <strong>die</strong> mit privatem Kapital errichteten, mautpflichtigen<br />
»turn-pike roads« .'<br />
Wie verlief <strong>die</strong> Entwicklung bei den Straßenfahrzeugen? In der römischen Periode<br />
waren eine Reihe von zwei- <strong>und</strong> vierrädrigen Gefährten <strong>für</strong> <strong>die</strong> unterschiedlichsten<br />
Zwecke vorhanden, wobei <strong>die</strong> schweren Lastkarren von Ochsen<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> leichteren Reisewagen von Pferden gezogen wurden . Die Achsen der<br />
Wagen waren fest mit dem Radkasten verb<strong>und</strong>en, was bei Kurvenfahrten hohe<br />
5<br />
.<br />
Eine besonders eindrucksvolle Schilderung einer Postkutschenreise in Preußen in den 20er Jahren<br />
des 19 . Jahrh<strong>und</strong>erts sei hier wiedergegeben : »Wer nicht eine Brust von Erz, Kaldaunen von<br />
Kupfer <strong>und</strong> einen Allerwertesten von Platin besitzt, dem raten wir wohlmeinend, dort keine Reise<br />
mit der sogenannten ordinären Postkutsche zu unternehmen, denn <strong>die</strong>se ist in der Tat gar zu<br />
ordinär . Der alte Kasten ruht unmittelbar auf der Achse, <strong>und</strong> <strong>die</strong> Sitze erinnern an <strong>die</strong> Härte des<br />
englischen Stahls ; Kunststraßen findet man nur in der Umgebung der Hauptstadt, <strong>und</strong> befährt<br />
man mit der ordinären Postkutsche <strong>die</strong> übrigen erbärmlichen Wege des Landes, so riskiert man<br />
geradezu, etliche Rippen zu brechen . Wer keinen eigenen Reisewagen hat, kommt mit der Extrapost<br />
nicht viel besser fort ; denn <strong>die</strong> Fahrzeuge, auf welche man zuweilen geladen wird, gleichen<br />
auf ein Haar dem Armesünderkarren . Die ordinäre Postkutsche bewegt sich mit unbeschreiblicher<br />
Langsamkeit vorwärts, st<strong>und</strong>enlang muß man auf jeder Station harren, <strong>und</strong> mir selbst ist es begegnet,<br />
daß ich mit solcher Gelegenheit in vier<strong>und</strong>zwanzig St<strong>und</strong>en kaum acht Meilen zurücklegte .«<br />
Zitiert nach Elfriede Rehbein, a .a .O ., S . 189 .<br />
Als Pioniere des modernen Chausseebaus (Packlager aus nach oben hin kleiner werdenden Schottersteinen,<br />
gute Drainage) gelten der Franzose Pierre Tresaguet (1716-1780), der Schotte John Mc<br />
Adam (1756-1836) <strong>und</strong> der Engländer Thomas Telford (1757-1834) . Vgl . Charles Singer u .a .<br />
(Hrsg .), A History of Technology, Bd . IV, Oxford 1958, S . 527-535 ; Maurice Daumas (Hrsg .), A<br />
History of Technology & Invention Progress Through the Ages, Bd . III, New York 1979, S .<br />
235-239 .<br />
6