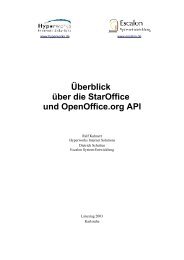- Seite 1 und 2: Leitfaden für die Migration von So
- Seite 3 und 4: Migrationsleitfaden Version 3.0 Lei
- Seite 5 und 6: Aufbau und Inhalt des Migrationslei
- Seite 7 und 8: Struktur und stärkere Modularisier
- Seite 9 und 10: Letztendlich hängt die Wahl der Mi
- Seite 11 und 12: Inhaltsverzeichnis Vorwort zur drit
- Seite 13 und 14: 3.6 Vergleichbarkeit...............
- Seite 15 und 16: 1.1 NetBIOS, WINS, DNS und DHCP unt
- Seite 17 und 18: 2.2 Migration von Kolab 2 nach MS E
- Seite 19 und 20: I. Modul Querschnittsthemen A Thema
- Seite 21 und 22: anforderungen bezüglich der Offenh
- Seite 23 und 24: Die Einführung von Workflow-System
- Seite 25 und 26: Die Integration von Programmen, Die
- Seite 27 und 28: hängig voneinander und über mehre
- Seite 29 und 30: Integration mit dem Gesamtsystem er
- Seite 31 und 32: � Durch die fehlende Offenlegung
- Seite 33 und 34: 3.6 Kriterien zur Beurteilung integ
- Seite 35 und 36: Open Enterprise Server Mit „Open
- Seite 37 und 38: UCS-Module Univention und andere He
- Seite 39 und 40: Kriterium Microsoft Novell Univenti
- Seite 41: B Thema: Rechtliche Aspekte von Sof
- Seite 45 und 46: möchte. Kommt es nicht zum Abschlu
- Seite 47 und 48: änderungen: Es enthält Klauseln,
- Seite 49 und 50: Rechtsinhaber ihren Sitz oder gewö
- Seite 51 und 52: und § 69e UrhG erworben hat, nacht
- Seite 53 und 54: kann dies ohne Weiteres tun, solang
- Seite 55 und 56: gebracht worden. Dieser erste Ansch
- Seite 57 und 58: Umfang der Rechtseinräumungen Risi
- Seite 59 und 60: Bei konkreten Hinweisen auf bestehe
- Seite 61 und 62: Beim Abschluss eines „Indemnifica
- Seite 63 und 64: 7.3 Einsatz von OSS: Vertragliche H
- Seite 65 und 66: 7.5 Einsatz von OSS: Außervertragl
- Seite 67 und 68: Allerdings spielt die außervertrag
- Seite 69 und 70: Wirtschaftlichkeitsentscheidung umg
- Seite 71 und 72: Unabhängigkeit auf Folgemärkten i
- Seite 73 und 74: C Thema: Wirtschaftliche Aspekte vo
- Seite 75 und 76: hauptstadt München― 68 , die im
- Seite 77 und 78: 3.1 Ziele und Rahmenbedingungen 3.1
- Seite 79 und 80: o Ist-Aufnahme (Anwendungslandschaf
- Seite 81 und 82: Phase Nr Beschreibung Seite 81 Vari
- Seite 83 und 84: 3.3.3.2 APC Auch auf der Seite der
- Seite 85 und 86: Gesamtmigrationen oftmals auch die
- Seite 87 und 88: terstützung der Geschäftsprozesse
- Seite 89 und 90: RZ - Infrastruktur - Netzwerk Erheb
- Seite 91 und 92: RZ - Infrastruktur - Zentrale Serve
- Seite 93 und 94:
4.8 IT-Fachverfahren Für die Fachv
- Seite 95 und 96:
IT-Fachverfahren22 - Datenbanksyste
- Seite 97 und 98:
IT-Fachverfahren5 - Ausblick, Koste
- Seite 99 und 100:
� Technische Änderungen beziehun
- Seite 101 und 102:
ae) Flexibilität Altsystem - Inter
- Seite 103 und 104:
g) Skalierbarkeit � Gibt es Anfor
- Seite 105 und 106:
Einen Gesamtüberblick der monetär
- Seite 107 und 108:
wert gebildet werden, mit dem dann
- Seite 109 und 110:
Kriteriengruppe 1.1.2.1 Hardwarekos
- Seite 111 und 112:
(Kosten lokal erforderlicher Anpass
- Seite 113 und 114:
Kriterium 1.1.3.5 Einarbeitungskost
- Seite 115 und 116:
� Die Ermittlung fragt grundsätz
- Seite 117 und 118:
Kriterium 2.2.1 Personalkosten aus
- Seite 119 und 120:
ten erst bewerkstelligen können. W
- Seite 121 und 122:
IT-Vorhaben: Migration von Server-
- Seite 123 und 124:
Kriterium 3.1.2.1 Fehler und Ausfä
- Seite 125 und 126:
Kriterium 3.2.2 Erfüllung Datensch
- Seite 127 und 128:
5.3.2 Qualitativ-strategische Krite
- Seite 129 und 130:
Kriterium 4.1.4 Pilot-Projekt-Chara
- Seite 131 und 132:
chen Gründen) ausgewechselt werden
- Seite 133 und 134:
lichen Standards folgen. Dies kann
- Seite 135 und 136:
Aufgabenbereiche verbunden sein. Zu
- Seite 137 und 138:
D Thema: Empfehlungen Die nachfolge
- Seite 139 und 140:
werden. Diese können aufgrund der
- Seite 141 und 142:
� Auswahl der Produkte zur Abdeck
- Seite 143 und 144:
ereitzustellen sind. Dieser Aspekt
- Seite 145 und 146:
enötigt. Der Directory Server ist
- Seite 147 und 148:
tlich, dass damit die Möglichkeite
- Seite 149 und 150:
2.3.3 Organisatorische Erfolgsfakto
- Seite 151 und 152:
� Transaktionsunterstützung Mitt
- Seite 153 und 154:
Mit MySQL 5.1 wurde eine Architektu
- Seite 155 und 156:
PostgreSQL ist für eine Reihe von
- Seite 157 und 158:
Der Source Code des Interbase-Daten
- Seite 159 und 160:
� Hot-Standby MaxDB erlaubt die K
- Seite 161 und 162:
Microsoft bietet vier Editionen des
- Seite 163 und 164:
Als Besonderheit bietet der Microso
- Seite 165 und 166:
kerne, allerdings gibt es für die
- Seite 167 und 168:
Die Lizenzmodelle orientieren sich
- Seite 169 und 170:
in nur einem Datenbanksystem in nor
- Seite 171 und 172:
anken zu erheblichen Migrationsaufw
- Seite 173 und 174:
� MySQL Migration Toolkit Das MyS
- Seite 175 und 176:
B Thema Webserver Der ursprünglich
- Seite 177 und 178:
Modul Funktion mod_autoindex Generi
- Seite 179 und 180:
Mittels HTTP 1.1 Kompression lassen
- Seite 181 und 182:
� Windows Skript Komponenten: Ent
- Seite 183 und 184:
Die hierbei zu lösenden Probleme s
- Seite 185 und 186:
2.2 Fortführung der Produktlinie v
- Seite 187 und 188:
C Thema Authentisierungs- und Verze
- Seite 189 und 190:
Kerberosprotokolls ist die Heimdal-
- Seite 191 und 192:
(zum Beispiel Person oder Organisat
- Seite 193 und 194:
Neben der Verwendung von Verzeichni
- Seite 195 und 196:
1.1.3 Heimdal-Kerberos /MIT Kerbero
- Seite 197 und 198:
Wichtige Änderungen gegenüber der
- Seite 199 und 200:
hat inzwischen den Support für NT
- Seite 201 und 202:
Eine Erweiterbarkeit um selbst defi
- Seite 203 und 204:
� wie mit Kennwörtern umgegangen
- Seite 205 und 206:
� Windows 2003 � Windows XP �
- Seite 207 und 208:
Active Directory enthält einen Reg
- Seite 209 und 210:
Abbildung 25: Beispiel NT-Domänens
- Seite 211 und 212:
Grundsätzlich werden Zertifikate z
- Seite 213 und 214:
2.1 Migration von Windows NT DC nac
- Seite 215 und 216:
Windows DC zum neuen Samba DC, ist
- Seite 217 und 218:
Ebenso muss genau analysiert werden
- Seite 219 und 220:
2.3.1.2 Migration der Kerberos basi
- Seite 221 und 222:
2.4.2.4 Zu beachtende Punkte � Se
- Seite 223 und 224:
D Thema Netzwerkdienste Die infrast
- Seite 225 und 226:
Microsoft empfiehlt beim Aufbau von
- Seite 227 und 228:
Record Typ Kurzbeschreibung A Adres
- Seite 229 und 230:
Nr. Optionsname Erklärung von Wind
- Seite 231 und 232:
Nr. Optionsname Erklärung von Wind
- Seite 233 und 234:
Der ISC dhcpd ermöglicht bezüglic
- Seite 235 und 236:
Eine Migration innerhalb einer Wind
- Seite 237 und 238:
der Tatsache, dass BIND 9 bezüglic
- Seite 239 und 240:
E Thema Dateiablage Für die physik
- Seite 241 und 242:
Für Datensicherung und Versionieru
- Seite 243 und 244:
W I N D O W S Ordner durchsuchen /
- Seite 245 und 246:
1.1.5 Abbildung der Überwachungsfu
- Seite 247 und 248:
1.2 Linux-Server mit NFS NFS (Netwo
- Seite 249 und 250:
Das ganzheitliche Konzept von OpenA
- Seite 251 und 252:
Zu jedem Ordner und jeder Datei wir
- Seite 253 und 254:
Ordner erstellen / Daten anhängen
- Seite 255 und 256:
Lokale Gruppen auf Member Servern d
- Seite 257 und 258:
� Distributed Link Tracking � D
- Seite 259 und 260:
� Gruppen mit dem Bereich „Loka
- Seite 261 und 262:
1.4.21 Fazit NTFS bietet alle Vorau
- Seite 263 und 264:
Dateiersterstellung zu übertragen.
- Seite 265 und 266:
samtlänge der Datei incl. Pfadanga
- Seite 267 und 268:
� Einbindung NT Server in eine vo
- Seite 269 und 270:
1.1.1.2 Quotas Die Funktion Quotas,
- Seite 271 und 272:
1.1.2 Unterstützung etablierter F
- Seite 273 und 274:
1.1.2.2 Die Druckerbeschreibungsspr
- Seite 275 und 276:
1.2.5 Druck und Druckeransteuerung
- Seite 277 und 278:
1.2.6 Technische Umsetzung der Trei
- Seite 279 und 280:
1.2.10 Werkzeuge CUPS hat ein „ei
- Seite 281 und 282:
1.3.1.2 Automatische Treiberinstall
- Seite 283 und 284:
� TCP/IP � NetBEUI � SPX/IPX
- Seite 285 und 286:
Druckgerät verwertet werden könne
- Seite 287 und 288:
Diese Ports ermöglichen im Gegensa
- Seite 289 und 290:
Setzt man die Microsoft Printserver
- Seite 291 und 292:
dowsrechnern benötigt wird. Um ein
- Seite 293 und 294:
G Thema System-Überwachungs- und -
- Seite 295 und 296:
Scotty ist ein weiteres Tool für V
- Seite 297 und 298:
� Benachrichtigung unterschiedlic
- Seite 299 und 300:
einer höheren Motivation bei den M
- Seite 301 und 302:
� Entdecken von Systemen � Remo
- Seite 303 und 304:
Bei beiden Installationen ist der E
- Seite 305 und 306:
chung, sondern auch Anwendungen fü
- Seite 307 und 308:
(CCSMT) das von Microsoft zur Verf
- Seite 309 und 310:
Der ZideLook Connector sowie instan
- Seite 311 und 312:
Groupware-Servers. Das ZideLook-Plu
- Seite 313 und 314:
Für das Jahr 2006 nennt Open-Xchan
- Seite 315 und 316:
Besonders vorteilhaft ist die Skali
- Seite 317 und 318:
Edition ist eine umfassende Komplet
- Seite 319 und 320:
Module Funktion Stundenzettel Zeite
- Seite 321 und 322:
Zarafa wird in Deutschland, Österr
- Seite 323 und 324:
Abbildung 35: LDAP-basierter grafis
- Seite 325 und 326:
Die zentrale Komponente ist der Kol
- Seite 327 und 328:
� Verwaltung mehrerer Maildomäne
- Seite 329 und 330:
Auf die Integration von Sicherheits
- Seite 331 und 332:
Abbildung 36: Scalix-Plattform Eine
- Seite 333 und 334:
Abbildung 38: Scalix - Versionen/Fu
- Seite 335 und 336:
Serverlizenzen für Exchange Server
- Seite 337 und 338:
Aus Sicht des Nutzers stellt Exchan
- Seite 339 und 340:
Die Funktionalität des Notes-Clien
- Seite 341 und 342:
Eine indirekte Migration via Client
- Seite 343 und 344:
tauschformat zu übertragen. Bei de
- Seite 345 und 346:
2.3.1 Durchführung einer Transitio
- Seite 347 und 348:
2.4.3 Datenexport per XML-RPC Für
- Seite 349 und 350:
2.5 Scalix nach eGroupware Dieses K
- Seite 351 und 352:
3 Bezüge 3.1 Webserver und Netzwer
- Seite 353 und 354:
� Teams bilden � Teammitglieder
- Seite 355 und 356:
Risikokapital Ende 2007 jedoch eing
- Seite 357 und 358:
tionen des Webservers genutzt werde
- Seite 359 und 360:
Bundesamt für Sicherheit in der In
- Seite 361 und 362:
Hauptfunktion Details Aktuelle Proj
- Seite 363 und 364:
WSS Seite 363 MOSS Abbildung 43: Be
- Seite 365 und 366:
1.2.1.2 Protokolle und Schnittstell
- Seite 367 und 368:
ist auch nicht die Aufgabe des Leit
- Seite 369 und 370:
netauftritt, Partner Web) aufzuteil
- Seite 371 und 372:
Funktionsbereiche Portal Services F
- Seite 373 und 374:
1.2.2.2 Metadaten Bevor Listen, Bib
- Seite 375 und 376:
Zusammenfassend lässt sich festhal
- Seite 377 und 378:
einzelnen Schritte des Workflows zu
- Seite 379 und 380:
� Das Anzeigen aller verfügbaren
- Seite 381 und 382:
Der SharePoint Designer bietet Mög
- Seite 383 und 384:
� O3Spaces Workplace Community Ed
- Seite 385 und 386:
Das Repository liegt unverschlüsse
- Seite 387 und 388:
Das Repository eines Workspaces kan
- Seite 389 und 390:
1.3.3 Fazit In heterogenen Umgebung
- Seite 391 und 392:
� Novell Open Enterprise Server 2
- Seite 393 und 394:
Werkzeuge Für die Konfiguration un
- Seite 395 und 396:
� Address Book Speichern von Adre
- Seite 397 und 398:
Kommunikation Bearbeiten Telefonkon
- Seite 399 und 400:
Abbildung 60: Erweiterte Suche Nove
- Seite 401 und 402:
Workflows Novell Teaming beinhaltet
- Seite 403 und 404:
1.4.2.2 Conferencing Funktionen Die
- Seite 405 und 406:
Welche der beiden Varianten in Frag
- Seite 407 und 408:
Web Browser LDAP-Verzeichnisserver
- Seite 409 und 410:
ihren Clients besitzen. Die Konnekt
- Seite 411 und 412:
figuriert werden. Wenn die Steuerun
- Seite 413 und 414:
o .doc/.xls/.ppt-Dateien von MS Wor
- Seite 415 und 416:
� Standard Diese Schablone stellt
- Seite 417 und 418:
Funktionen Details E-Mail Mit Hilfe
- Seite 419 und 420:
� Team-Blog Dieser Bereichstyp er
- Seite 421 und 422:
C Thema Office / Desktop 1 Produkte
- Seite 423 und 424:
Weitere Neuerungen finden sich im B
- Seite 425 und 426:
Impress (Präsentation) Impress ist
- Seite 427 und 428:
.NET-Familie, (vorausgesetzt, es is
- Seite 429 und 430:
Google Docs and Spreadsheets, die e
- Seite 431 und 432:
� Zusätzliche Schriftarten � E
- Seite 433 und 434:
Die Fähigkeit zur Webservice-basie
- Seite 435 und 436:
Windows - Office Anwendung Basic Ho
- Seite 437 und 438:
� Globale Rechtschreibprüfung, d
- Seite 439 und 440:
spiel Updates und Suchdienste. Dar
- Seite 441 und 442:
und rufen bestimmte Ereignisprozedu
- Seite 443 und 444:
Präsentation) über folgende, teil
- Seite 445 und 446:
Die nachfolgende Abbildung zeigt ei
- Seite 447 und 448:
� Unterstützung für die Web Ser
- Seite 449 und 450:
Lizenzierung Verfügbarkeit für Be
- Seite 451 und 452:
Beispiel der Textverarbeitung darge
- Seite 453 und 454:
Problem zurückgeführt. Tatsächli
- Seite 455 und 456:
o Dokumente und Vorlagen, die nicht
- Seite 457 und 458:
2.2.2 Wahl eines geeigneten Konvert
- Seite 459 und 460:
PowerPoint (.ppt) Anwendung Problem
- Seite 461 und 462:
Abbildung 70: Architektur des Dokum
- Seite 463 und 464:
Migration Planning Manager 436 (OMP
- Seite 465 und 466:
2.5 Migration von StarOffice 7/8 u.
- Seite 467 und 468:
nen Möglichkeit, externe Datenbest
- Seite 469 und 470:
Dennoch können sich Probleme bei d
- Seite 471 und 472:
D Thema Backend-Integration 1 Produ
- Seite 473 und 474:
Framework wird eine große Anzahl a
- Seite 475 und 476:
Das erklärte Ziel von DotGNUs Port
- Seite 477 und 478:
Der Applikationsserver bietet den K
- Seite 479 und 480:
� Oracle Application Server. 463
- Seite 481 und 482:
� omniORB 468 , � JacORB 469 un
- Seite 483 und 484:
werden, zum Beispiel SWT 477 (Open
- Seite 485 und 486:
Migrationsprojekte einfließen kön
- Seite 487 und 488:
E Thema Terminal-Dienste und Client
- Seite 489 und 490:
Vorteile Erläuterung anforderungen
- Seite 491 und 492:
1 Produkte / Technologien 1.1 Linux
- Seite 493 und 494:
Die NX-Komprimierungstechnologie er
- Seite 495 und 496:
Die Konfiguration von Anwendungen f
- Seite 497 und 498:
� Advanced Edition: Die Advanced
- Seite 499 und 500:
Die Entscheidung selbst ist der ers
- Seite 501 und 502:
An dieser Stelle soll nochmals beto
- Seite 503 und 504:
Die Installation der Clients gestal
- Seite 505 und 506:
software auftreten, wobei sich dies
- Seite 507 und 508:
ckelt wurden. So können zum Beispi
- Seite 509 und 510:
BDC Backup Domain Controller BfD Bu
- Seite 511 und 512:
EFQM European Foundation for Qualit
- Seite 513 und 514:
ISA Internet Security and Accelerat
- Seite 515 und 516:
MTTR Mean Time To Repair NAS Networ
- Seite 517 und 518:
RFCs Request for Comments RHCE Red
- Seite 519 und 520:
u. ä. und ähnliches u. U. unter U
- Seite 521 und 522:
B Glossar .NET .NET ist die Bezeich
- Seite 523 und 524:
DNS Das Domain Name System ist ein
- Seite 525 und 526:
Makro Eine Kombination einzelner An
- Seite 527 und 528:
ein Netzwerk angeschlossene Rechner
- Seite 529 und 530:
Abbildung 28: B-G-R Methode .......
- Seite 531 und 532:
D Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Au
- Seite 533 und 534:
Tabelle 57: Beispiele für Autorisi
- Seite 535 und 536:
WiBe Migrationen Bezeichnung Kriter
- Seite 537 und 538:
WiBe Migrationen Bezeichnung Kriter
- Seite 539 und 540:
3 Rechtsgrundlagen BHO 512 , § 7 W
- Seite 541 und 542:
2.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
- Seite 543:
3 Interessenbekundungsverfahren 516