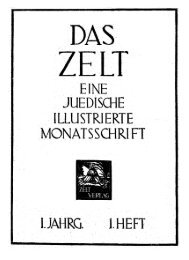Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
deren Verständnis gewöhnliche Menschen aufgrund ihres<br />
Mangels an poetischer Wahrnehmung ausgeschlossen<br />
sind und die sie aufgrund ihrer anti-poetischen Erziehung<br />
(außer vielleicht im wilden Wales) nicht mehr<br />
zu achten wissen. 7<br />
An anderer Stelle sagt Ranke-Graves:<br />
Tatsächlich beruht die poetische Überlieferung Europas<br />
letztlich auf magischen Prinzipien, deren Rudimente<br />
jahrhundertelang ein streng gehütetes religiöses Geheimnis<br />
bildeten, das aber zuletzt verstümmelt, entehrt<br />
und vergessen wurde. 8<br />
Wir haben seit Kapitel 1 mehrfach gehört, daß<br />
in der Sprache selbst das Geheimnis liegt, das es<br />
zu entdecken gilt. Arno Schmidt meinte: „… ein<br />
Teil der Sprache … entspricht einer Ab-<br />
Sonderung unserer Keim-Drüsen.“ 9 Und Valéry<br />
schreibt, noch erstaunlicher: „Was ich sagen will<br />
und was ich verlauten lasse, schließt nicht die<br />
Bedeutung der Wörter ein, die ich gebrauche.“ 10<br />
Ranke erläutert die Schwierigkeit:<br />
Eine weitere Komplikation war dadurch bedingt, daß die<br />
poetische Ausbildung in alter Zeit — wenn wir aufgrund<br />
des irischen »Book of Ballymote« urteilen, das einen<br />
kryptographischen Schlüssel enthält —, darin bestand,<br />
die Sprache so schwierig wie möglich zu gestalten, um<br />
das Geheimnis zu wahren. 11<br />
Der einfache Mensch (z.B. der Spielmann) kann<br />
die Mythen erzählen, ohne den Hintersinn zu<br />
verstehen, wie West darlegt:<br />
Der Mythos kann als ein Medium benutzt werden, um<br />
solides Wissen weiterzugeben, und zwar unabhängig<br />
vom Grad der Einsicht jener Menschen, welche die Geschichten,<br />
Sagen usw. jeweils erzählen. In alten Zeiten<br />
gestattete diese Sprache den Mitgliedern des archaischen<br />
»braintrust« überdies, in der Gegenwart von Laien ungestört<br />
zu »fachsimpeln«: Die Gefahr, etwas auszuplaudern,<br />
war praktisch gleich Null. 12<br />
Die Hoffnung ist gering, daß wenigstens diejenigen,<br />
die wortgewandt darüber entscheiden, was<br />
Kunst ist, im Besitz einer höheren Weisheit sind.<br />
Gisela Brackert nennt sie »Priesterkaste der Experten«<br />
oder »Priesterkaste der Kunstvermittler«<br />
13 . Rühmkorf urteilt: „… nur wird wer gar<br />
nicht weiß, was irgendwann mal Sache war, niemals<br />
erahnen, was mit Kunst noch möglich ist.“ 14<br />
Und auf einen Stich gegen die Germanistik kann<br />
er auch nicht verzichten: „… manches, was der<br />
Ahnungslosigkeit vom Dienst als absolute Unerhörtheit<br />
erscheint, hat sich in einem stillverborgenen<br />
Unschuldwinkel lange klangvoll vorgebildet.“<br />
15 Dazu muß man sich verdeutlichen, daß die<br />
Gegenstände der pornographischen Reizdichtung<br />
und der impuristischen Kunst dieselben sind,<br />
nämlich die OG in Form und Funktion. Der<br />
24<br />
Unterschied liegt in der Art der Darstellung (direkt<br />
oder sublimiert) und in der Wirkung beim<br />
Leser (körperliche oder geistige Erregung). Die<br />
Kenner klären den Leser aber nicht auf, z.B.<br />
Rimbaud: „Nun kann ich sagen, daß die Kunst<br />
ein Gedumme ist.“ 16 Baudelaire wird deutlicher:<br />
„Was ist Kunst? Prostitution.“ 17 Um das zu merken,<br />
muß man aber sehr aufmerksam sein. Ähnlich<br />
sagt auch Wilde: „Alle Kunst ist unmoralisch.“<br />
18 Und noch allgemeiner wird Artaud: „Alles<br />
Geschriebene ist Schweinerei.“ 19 Dieser Satz<br />
ist für uns keine Überraschung, sondern bestätigt<br />
die oben untersuchte Bedeutung und Herkunft der<br />
Laute und Buchstaben. Hopkins versteckt sich<br />
(mit Kepler) etwas mehr: „Dichtkunst ist Geometrie<br />
im wahrsten Sinne des Wortes“ 20 , nämlich<br />
»Erdvermessung« (GV), wie wir in Kapitel 14<br />
gesehen haben.<br />
Wir müssen den Begriff »Impurismus«, den<br />
wir hier als Bezeichnung eines Weltbildes und<br />
einer Literaturströmung verwenden, genauer erläutern,<br />
indem wir ihn gegen seine bekannten<br />
Nachbarn abgrenzen, die »littérature pure« und<br />
die »littérature engagée«. Mit diesen Begriffen<br />
sind wir bei der Beziehung zwischen Literatur<br />
und Gesellschaft, also bei der Frage, ob ein<br />
Schriftsteller sich in den Dienst einer Sache stellen<br />
darf oder muß. Wir denken an sogenannte<br />
»religiöse Dichtungen«. Auch lehrhafte, heldischvaterländische,<br />
moralisch-sittliche Werke können<br />
als Beispiel dienen. Die »engagierte Literatur« ist<br />
einer Idee verpflichtet, steht vor allem im Dienst<br />
einer politischen oder sozialen Bewegung. In<br />
seinem Essay Was ist Literatur? hat Sartre das<br />
Schlagwort geschaffen und den Prosaschreiber<br />
zum Engagement verpflichtet. In Deutschland<br />
folgte ihm Brecht, und in den ehemaligen Ostblockstaaten<br />
stand die Literatur beinah zwangsweise<br />
im Dienste des Kommunismus. Für Lenin<br />
war Literatur eine Form der Agitation, bei Majakovskij<br />
richtet sich der Wert der Dichtung nach<br />
dem »sozialen Auftrag«, und er meint: „Mit dem<br />
Märchen von der unpolitischen Kunst muß radikal<br />
aufgeräumt werden.“ 21 Johannes R. Becher<br />
formuliert: „Ich diene auch als Dichter dem Befreiungskampf<br />
des Proletariats“ 22 , und Rolf<br />
Hochhuth urteilt: „Der engagierte Künstler ist der<br />
Künstler überhaupt.“ 23 Dagegen weist Peter<br />
Handke in seinem Aufsatz Die Literatur ist<br />
romantisch (1966) überzeugend nach, daß es den<br />
engagierten Künstler gar nicht gibt und daß ein