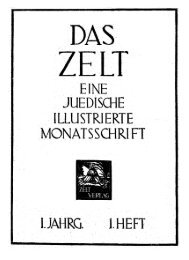Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Figur, die jetzt aussieht wie das oben erläuterte<br />
Bild von Magritte (»Die Vergewaltigung«).<br />
Ranke berichtet: „Eine assyrische Skulptur …<br />
zeigt das Jahr als einen Baum mit dreizehn Ästen.<br />
Der Baum ist am Stamm mit fünf Bändern<br />
umwunden, und die szepterähnlichen Äste stehen<br />
je sechs zu beiden Seiten, einer an der Spitze.“ 36<br />
Farbtafel Anh. 3.2 »Das Baumalphabet in<br />
der Tetraktys«. Hier wird das hyperboreische<br />
Baumalphabet auf den zwanzig Plätzen einer<br />
doppelten Tetraktys dargestellt. Jeder Baum kann<br />
auch eine männliche Bedeutung haben, wie Walker<br />
andeutet: „Johannes der Täufer benutzte ähnlich<br />
wie Paulus ein Baumgleichnis: »Schon ist die<br />
Axt an die Wurzel der Bäume gelegt« (Matthäus<br />
3,10). In heidnischen Zusammenhängen bedeutet<br />
dies die Kastration des Fruchtbarkeitskönigs.“ 37<br />
Deshalb finden sich jetzt an jedem Punkt unserer<br />
Zeichnung zwei impuristische Lösungen, und<br />
zwar oben im blauen Dreieck primär die weiblichen,<br />
unten im grünen Dreieck primär die männlichen.<br />
Diese Einteilung wurde durch folgenden<br />
Satz angeregt: „Nachdem der Zauber, den die<br />
Daktylen lehrten, ein orgiastischer war, enthielt er<br />
bezeichnenderweise 20 Elemente — sozusagen<br />
die Finger der Hände einer Frau und ihres Geliebten;<br />
doch Pythagoras begnügte sich damit, allein<br />
über die Tetraktys seiner eigenen zehn Finger zu<br />
spekulieren.“ 38 Damit werden zwei Gruppen zu je<br />
zehn Elementen (Lauten) in einer Tetraktys<br />
unterschieden und als männlich und weiblich<br />
bezeichnet. „Falls Pythagoras … von den Daktylen<br />
in dieses alphabetische Mysterium eingeführt<br />
wurde, dann wäre es möglich, daß er auch seine<br />
Theorie der mystischen Zahlenbedeutungen von<br />
ihnen übernahm.“ 39 Ranke hält die alte Zählung<br />
von 1 bis 13 für weniger gut geeignet als die Reihe<br />
des Pythagoras von 1 bis 20 40 , wie sie in der<br />
doppelten Tetraktys festgehalten wird. Diese<br />
Reihe sei griechisch (mit Vokalen), entspreche<br />
dem Hymnus und enthülle „eine deutlichere<br />
Annäherung an die poetische Wahrheit“ als das<br />
„alte bardische System der Buchstaben-Zahlen“.<br />
Das kann man gleich am Anfang sehen, wenn<br />
durch die Zählung des »A« auf Platz 1 das »B«<br />
auf Platz 2 gerät, wo es auch nach unseren Analysen<br />
hingehört. Auch 6:F [v] und 7:S [z] liegen<br />
dann wie im Alefbet. Die Anordnung der Laute<br />
beginnt oben links und verläuft zeilenweise<br />
bustrophedisch. Dadurch liegt der Todes-<br />
konsonant 19:R am Ende, „wie es dem Ende des<br />
Neunzehn-Jahres-Zyklus wohl angemessen ist.“ 41<br />
Von da kehrt die ganze Bewegung über den<br />
Vokal des Todes (20:i) zum Ausgangspunkt zurück,<br />
dem Vokal der Geburt (1:A), wodurch auch<br />
in diesem Bild ein Zyklus entsteht. Durch den<br />
Zusammenfall der Dreiecksspitzen in der Mitte<br />
liegen 10:U und 20:I an der gleichen Stelle, „wo<br />
das männliche und das weibliche Prinzip sich<br />
vereinigen.“ 42 Die Buchstaben D und T auf dem<br />
11. und 12. Platz nennt Ranke die „Zwillings-<br />
Anführer der Zwölfergruppe“ 43 . Tatsächlich<br />
haben sie eine Marschgruppe von zehn in der<br />
(blauen) keilförmigen Gruppe hinter sich. Im<br />
irischen System ist die Reihenfolge von D und T<br />
vertauscht 44 , wodurch das T die 11 und das D die<br />
12 repräsentiert, was auch mit unseren Analysen<br />
besser zusammenstimmt. Daß die beiden etwas<br />
Zwillingshaftes haben, sieht man an den Sternzeichen,<br />
die auf Tafel Anhang 3.1 im Außenring<br />
(in Schwarz!) hinzugefügt wurden: D und T müssen<br />
beide dem Krebs zugeordnet werden, wenn<br />
man die dreizehn Mondmonate zeitlich annähernd<br />
richtig auf die zwölf Sternzeichen verteilen<br />
will. Warum die roten Sternzeichen im Innern<br />
versetzt sind, wird gleich erklärt.<br />
Ranke-Graves analysiert nicht nur die Bäume,<br />
sondern auch etliche »Sätze« von Zuordnungen,<br />
um den verlorenen Hintersinn der Buchstaben<br />
anzudeuten, z.B. Planeten und Wochentage,<br />
Edelsteine, die Stämme Israels 45 , Vögel, Farben<br />
und die 13 Embleme: Hirsch / Stier (B), Flut (L),<br />
Wind (N), Tautropfen (F), Falke (S), Blume (H),<br />
Freudenfeuer (D), Speer (T), Lachs (C), Hügel<br />
(M), Keiler (G), Welle (Ng), Seeschlange (R).<br />
Dazu passen vielleicht die 13 Schätze Britanniens,<br />
die Walker als Zeichen der Mondmonate<br />
nennt: Schwert, Korb, Trinkhorn, Wagen, Halfter,<br />
Messer, Kessel, Wetzstein, Gewand, Pfanne,<br />
Platte, Schachbrett, Mantel. 46 Ranke leitet die<br />
»Embleme« aus seiner Rekonstruktion einer<br />
Dichtung Gwions ab, »Amergins Lied« 47 , das wir<br />
auf Tafel Anhang 3.2 links übernommen haben.<br />
Ranke selbst setzt es nach seinen Einsichten für<br />
die Vokale im gleichen Stile fort:<br />
A = Ich bin der Schoß jeder Höhle,<br />
O = Ich bin die Flamme auf jedem Hügel,<br />
U = Ich bin die Königin jedes Bienenstocks,<br />
E = Ich bin der Schild für jedes Haupt,<br />
I = Ich bin das Grab für jede Hoffnung. 48<br />
411