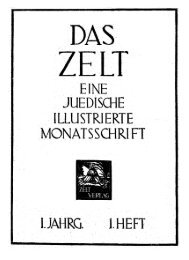Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
»modern« als 1910-1945. Das erwähnte »Spiel«<br />
und damit auch die »Weltsprache« sind aber<br />
überhaupt nicht modern, sondern leben diachron,<br />
durch die Jahrtausende, sicher seit dem altägyptischen<br />
Totenbuch, vermutlich auch seit dem<br />
Gilgamesch-Epos von Uruk (ca. 2600 v.Chr.), der<br />
ältesten überlieferten Literatur. Es mag sein, daß<br />
die Strömung sich im 20. Jahrhundert so breit<br />
entwickelte, daß sie überhaupt zum Charakteristikum<br />
der Moderne wurde. Vielleicht meinte Rimbaud<br />
diesen Zustand, als er 1871 sagte: „Da im<br />
übrigen jedes Wort eine Ein=Sicht ist, wird die<br />
Zeit einer universellen Sprache kommen!“ 100 Das<br />
meint auch Höllerer: „Die Epoche der lyrischen<br />
Weltsprache ist da, oder sie wird kommen.“ 101 In<br />
anderen Zeiten muß es neben dem Impurismus<br />
andere Formen der Kunst, auch der sprachlichen,<br />
gegeben haben, die den Namen »Kunst« oder<br />
»Poesie« trugen und ihn auch (nach anderen<br />
Maßstäben) verdienten. Eine Abgrenzung wird<br />
man vornehmen können, wenn der Impurismus in<br />
allen Nationalliteraturen gründlich erforscht ist.<br />
Viele der älteren Autoren haben ihr Wissen so<br />
versteckt, daß man es kaum wiederfinden kann.<br />
So rühmt z.B. F. G. Lorca seinen Landsmann<br />
Don Luis de Góngora (1561-1627) als „Vater<br />
unsrer Sprache“ 102 : „Die alten Intellektuellen,<br />
Liebhaber der Poesie zu seiner Zeit, mußten<br />
sprachlos geworden sein, als sie sahen, daß das<br />
Kastilische in eine ihnen fremde Sprache sich<br />
verwandelte, die sie nicht zu entziffern wußten.“<br />
103 Góngora war königlicher Kaplan und<br />
hatte damit allen Grund, das impuristische Thema<br />
seiner Dichtungen hinter erhabenen Ausdrücken,<br />
lateinischen Satzbildungen, klassischer Gelehrsamkeit<br />
und „Transformationen der Mythologie“<br />
zu verbergen. „Aber um an ihn heranzukommen,<br />
muß man in die Poesie eingeweiht sein und eine<br />
durch Lektüre und Erfahrungen vorbereitete<br />
Phantasie haben.“ 104 Und weiter Lorca bei seinen<br />
Überlegungen zu Góngora: „Der Dichter muß<br />
einen Plan von den Gegenden haben, die er<br />
durchstreifen will, und er muß … vorsichtig das<br />
durchpulste und reale Fleisch bespähen, das mit<br />
dem Gedichtplan übereinstimmt … Er jagt das<br />
Bild, das sonst kaum jemand sieht, weil kaum<br />
jemand seine Bezüglichkeiten findet.“ 105<br />
Wir müssen der Versuchung widerstehen, eine<br />
lange Liste von Dichtern und Werken vorzulegen,<br />
in denen man den impuristischen Gegenstand<br />
wahrscheinlich erfolgreich suchen wird. Doch<br />
32<br />
sollen einige Ansatzpunkte genannt werden. Von<br />
den altindischen Upanishaden (ab 800 v.Chr.)<br />
zum Bhagavadgita-Gesang (800 n.Chr.), von der<br />
Offenbarung des Johannes (95 n.Chr.) bis zu den<br />
Merseburger Zaubersprüchen (10. Jh.), von Ovids<br />
Metamorphosen (ca. 2-8 n.Chr.) zu Dantes Göttlicher<br />
Komödie (ca. 1311-21) reicht die Klammer.<br />
Das Tao-te-king (Buch vom Weg und seiner<br />
Kraft) des Chinesen Lao-Tse (um 300 v.Chr.)<br />
enthält nach Francis „alle fundamentalen Lehrsätze<br />
esoterischer Kosmogenese.“ 106 Die Gralslegende<br />
in Wolfram von Eschenbachs Epos Parzival<br />
(ca. 1200-1210 n.Chr.) wird z.B. bei Shuttle<br />
& Redgove immer wieder zur Auswertung herangezogen<br />
und scheint eine geschlossene impuristische<br />
Deutung zu ermöglichen; und Arno Schmidt<br />
sagt: „… die ganze mittelalterliche Dichtung<br />
liefert hier einen der Ewigen Jagdgründe.“ 107<br />
Ranke-Graves meint, „… man könne den Dichter<br />
gut danach beurteilen, wie genau er die Weiße<br />
Göttin porträtiert. Shakespeare kannte und fürchtete<br />
sie.“ 108 Bei Ranke finden sich weitere Namen:<br />
Donne, John Clare, Keats, Coleridge,<br />
Wordsworth, Scott, Andrew Man, Ben Johnson,<br />
John Skelton, William Blake, James Macpherson.<br />
Und wir fügen die zwei hinzu, die Schmidt für<br />
ganz große Köpfe hält: Lewis Carroll und James<br />
Joyce. Mit dem Roman Finnegans Wake ist auch<br />
die Schranke der Poesie als Grenze durchbrochen.<br />
Der russische Dichter und Nobelpreisträger<br />
Joseph Brodsky schrieb 1988 109 einen Artikel<br />
Das Gedicht ist die beste Kompaßnadel und<br />
nennt darin 55 Dichternamen, die er grundlegend<br />
empfiehlt. Bekannt ist die Würdigung vieler Kollegen<br />
in Benns Essay Probleme der Lyrik 110 .<br />
Ebenso nennen Rimbaud 111 und Zimmermann 112<br />
viele Namen. In seinem Museum der modernen<br />
Poesie hat Enzensberger 96 Autoren aus 20 Ländern<br />
versammelt. Hinzu kommen dann noch einige,<br />
die vor 1910 gedichtet haben: Whitman, Baudelaire,<br />
Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Breton,<br />
Novalis, Brentano, Pound, Flaubert. Protagonisten<br />
seien auch Nerval, Poe, Dickinson, Lautréamont,<br />
Hopkins, Laforgue, Block, Yeats, meint<br />
HME im Vorwort. Da fehlen immer noch neuere<br />
Namen wie Bachmann, Celan, Heißenbüttel,<br />
Hermlin, Kaschnitz und Krolow. Besonders interessant<br />
erscheint uns folgender Hinweis auf<br />
Keats, wenn Ranke berichtet: „Keats war damals<br />
24 Jahre alt und befand sich in einer kritischen<br />
Verfassung. Er hatte die Medizin um der Literatur