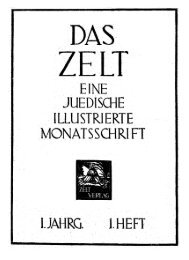- Seite 1 und 2: Wolfgang Werner Impurismus II Die B
- Seite 3 und 4: Bibliographische Informationen Der
- Seite 5 und 6: Clemens Brentano: Verzweiflung an d
- Seite 7 und 8: Zu Kapitel 8: Das doppelte Weltbild
- Seite 9 und 10: 10 Athanasius Kircher: Der Sefiroti
- Seite 11 und 12: asl - Con asl = anilingere (am As l
- Seite 13 und 14: des - fer des = desiderare (begehre
- Seite 15 und 16: HB - koll HB = Harnblase (Vesica ur
- Seite 17 und 18: MoV - plic MoV = Mons veneris (Scha
- Seite 19 und 20: Prost - rv Prost = Prostata (Vorste
- Seite 21 und 22: Tss - Zoo Tss = Testes (Hoden): sel
- Seite 23 und 24: deren Verständnis gewöhnliche Men
- Seite 25 und 26: äußeren Welt auszudrücken, diese
- Seite 27 und 28: Das Material des Gedichteschreibers
- Seite 29 und 30: [‘océano’ Vul-Vag]; ohne die A
- Seite 31 und 32: »modern« als 1910-1945. Das erwä
- Seite 33 und 34: Sprache muß insofern ein einziges
- Seite 35 und 36: archaische Tiefen hinableuchten« w
- Seite 37: (ff: Luft), »rühren« (rr: bewege
- Seite 41 und 42: nox/nux; monstruosus/menstruosus. A
- Seite 43 und 44: Leib ist das All dumpf zusammengedr
- Seite 45 und 46: 46 Was bedeutet das? 5 »RE am Begi
- Seite 47 und 48: 48 65 Was bedeutet das? Das ist der
- Seite 49 und 50: Und was die Himmelskuh (Vul) betrif
- Seite 51 und 52: 200 Da entstand jener sein Name »K
- Seite 53 und 54: 265 der das Gesicht (PVC) eines Hun
- Seite 55 und 56: »Dem Nachtmahle (CS-Nahrung) gegeb
- Seite 57 und 58: Spruch 39 Über Apophis. Struktur:
- Seite 59 und 60: 60 damit wir (die wG- & die mG-Göt
- Seite 61 und 62: 62 55 (NN als PVC-Osiris:) Ich bin
- Seite 63 und 64: Spruch 64 Über das Herausgehen am
- Seite 65 und 66: 66 Geprüft (registriert von Prost-
- Seite 67 und 68: Ich bin gekommen (dto.), um RE (GP)
- Seite 69 und 70: Spruch 85 Über den BA. Die Bedeutu
- Seite 71 und 72: 72 Spruch 108 Über Tss-Seth. Spruc
- Seite 73 und 74: 20 (Tss-Epi zu NN-Spum iGGS:) »Kom
- Seite 75 und 76: 76 Ich habe eure Opfer (Injat) für
- Seite 77 und 78: 78 Spruch 182 Über Thot als Pavian
- Seite 79 und 80: 80 der du fortgesetzt bleibst (er k
- Seite 81 und 82: doch bei jedem Wort die eigentliche
- Seite 83 und 84: öse; Streit; alius = der andere. -
- Seite 85 und 86: Aber dazu auch holl. kull = mG, als
- Seite 87 und 88: Anmerkungen: 1: auch Saft wegen Lau
- Seite 89 und 90:
7 Leuchter (mG: Gemeinden) und 7 St
- Seite 91 und 92:
Lama Hure Babylon Schwarzmond Vul m
- Seite 93 und 94:
erichtet) in den Templerkreuzen der
- Seite 95 und 96:
das Jüngste Gericht erwartet, eine
- Seite 97 und 98:
6-7-8), auf dem die Hure Babylon re
- Seite 99 und 100:
VIII. Christus als Reiter und Welte
- Seite 101 und 102:
hast du (Positives), daß du die We
- Seite 103 und 104:
(Cl-Johannes:) 6 Wer Ohren (Tss) ha
- Seite 105 und 106:
(Cl-Johannes:) 3 Und niemand im Him
- Seite 107 und 108:
noch über irgendeinen Baum (Vul).
- Seite 109 und 110:
(TMV) und die Luft (PVC) von dem Ra
- Seite 111 und 112:
(mG-Engel:) »Stehe auf (eri) und m
- Seite 113 und 114:
IV ist auch »Macht«) seines Chris
- Seite 115 und 116:
Harfen (VV) spielen (pls), 3 und si
- Seite 117 und 118:
(PVC) der Völker (Lami) (Lu: der H
- Seite 119 und 120:
[2. Die Hure Babylon (Vag-Vul) auf
- Seite 121 und 122:
Stunde (Vul; lat. ‘hora’, pers.
- Seite 123 und 124:
[Teil VIII. Christus als Reiter und
- Seite 125 und 126:
nes oder w genommenes) in den Büch
- Seite 127 und 128:
[2. Der Baum des Lebens (wG)] DAS 2
- Seite 129 und 130:
Analyse Charles Gounod: Mors et Vit
- Seite 131 und 132:
Tuba (Vag) mirum (aper) spargens (p
- Seite 133 und 134:
Preces (Tss) meae non sunt dignae (
- Seite 135 und 136:
(PVC-Seraphim-Engel:) 10. Solo (Ten
- Seite 137 und 138:
(PVC-Jesus:) Venite (agdi), benedic
- Seite 139 und 140:
Siehe da, die Hütte (Vag) Gottes (
- Seite 141 und 142:
1. Kyrie (Per spricht als Mensch:)
- Seite 143 und 144:
et iterum (it) venturus (agdi) est
- Seite 145 und 146:
Analysen Aus den »Kinder- und Haus
- Seite 147 und 148:
CoRu-Tischbeinen.) Da kam eine Baue
- Seite 149 und 150:
treuen Diener verlieren, und wäre
- Seite 151 und 152:
2. Der Froschkönig oder Der eisern
- Seite 153 und 154:
(4: Der Froschkönig und der eisern
- Seite 155 und 156:
herein) und sprach: „Guten Abend,
- Seite 157 und 158:
Türe (Lama). „Wer ist draußen?
- Seite 159 und 160:
Esel usw.“ Mit dem Imperativ crep
- Seite 161 und 162:
Tischchen, dem Goldesel und dem Sac
- Seite 163 und 164:
Swinegel machte die Haustür (Lami)
- Seite 165 und 166:
Notlage mit seiner Frau, und die St
- Seite 167 und 168:
8. Sneewittchen [Vorbemerkungen] [U
- Seite 169 und 170:
vorstellbar, denn Sneewittchen ist
- Seite 171 und 172:
»Glaskörper« des Vul-Vag-Auges.
- Seite 173 und 174:
sie sich nebeneinander auf das Moos
- Seite 175 und 176:
Beute fahren ließ. (Auf Farbtafel
- Seite 177 und 178:
(Lami als Menge gesehen), der Küch
- Seite 179 und 180:
so ward die Königstochter genannt,
- Seite 181 und 182:
(defä) von Brot (Per in der Fae-Fo
- Seite 183 und 184:
miteinander reif.“ Sie antwortete
- Seite 185 und 186:
„Kämm uns (mit den Cl-Zinken des
- Seite 187 und 188:
clau iVag), das kann unmöglich die
- Seite 189 und 190:
14. Allerleirauh [Vorbemerkungen] [
- Seite 191 und 192:
einmal erschien mit einem Brausen e
- Seite 193 und 194:
spricht Rapunzel einmal von »herau
- Seite 195 und 196:
(ColG/CoP) und weinte (plu). Zwei v
- Seite 197 und 198:
um einen reich gedeckten (lip) Tisc
- Seite 199 und 200:
iefen sie: „Der Wolf ist tot! Der
- Seite 201 und 202:
und nicht einmal mehr Wasser (Urn)
- Seite 203 und 204:
und die Tiere Tss, nach dem Zusamme
- Seite 205 und 206:
ßen das Messer (Cl) in einen Baum
- Seite 207 und 208:
Baum sitzen. Die gab vor zu frieren
- Seite 209 und 210:
so kommt (!) ein gewaltiger Frost (
- Seite 211 und 212:
(Scr) und kommt schnell fort.“ De
- Seite 213 und 214:
Position des entrückten Gottessohn
- Seite 215 und 216:
glänzte wie hunderttausend Karfunk
- Seite 217 und 218:
‘Schit’). Lat. ‘tabula’ ist
- Seite 219 und 220:
Der Großknecht sprach: „Fahrt nu
- Seite 221 und 222:
‘hira’ Darm)“. Und damit verg
- Seite 223 und 224:
verwünscht, wie sie Nächte mit de
- Seite 225 und 226:
gütig und anscheinend allwissend w
- Seite 227 und 228:
27. Ergänzung: Impuristische Motiv
- Seite 229 und 230:
Arthur Rimbaud Analysen Einzelne Ge
- Seite 231 und 232:
Arthur Rimbaud Vokale (Sublineare
- Seite 233 und 234:
6: Eis (Rig): ‘glaciers’ »Glet
- Seite 235 und 236:
25 DU KÖNIGLICHE KUNST (Res), nich
- Seite 237 und 238:
Friedrich Schiller An die Freude 1.
- Seite 239 und 240:
7. Tss: FREUDE (VS) sprudelt (lp) i
- Seite 241 und 242:
Clemens Brentano Verzweiflung an de
- Seite 243 und 244:
Text: In: H.M. Enzensberger: Brenta
- Seite 245 und 246:
Clemens Brentano Wiegenlied eines j
- Seite 247 und 248:
5: schreiend (men): lat. ‘clamare
- Seite 249 und 250:
Auslaufen der Rennwagen im Zirkus«
- Seite 251 und 252:
7: Herden (Per): engl. ‘flocks’
- Seite 253 und 254:
Text: Ingeborg Bachmann: Sämtliche
- Seite 255 und 256:
med. ‘Scapus pili’ (Per) »der
- Seite 257 und 258:
29: Dattelkern (Cl): Formanalogie.
- Seite 259 und 260:
Analysen Lyrik aus »Verteidigung d
- Seite 261 und 262:
Text: Verteidigung der Wölfe, S. 9
- Seite 263 und 264:
VVaper), doch für die Engländer m
- Seite 265 und 266:
(VS): rw. ‘Möser’, ‘Meser’
- Seite 267 und 268:
und ‘damn’ (‘damned’) »ver
- Seite 269 und 270:
Kleiner Herbst Dämon Nach Schwefel
- Seite 271 und 272:
Für Lot, einen makedonischen Hirte
- Seite 273 und 274:
Titel: Lot (Per/Sod). — makedonis
- Seite 275 und 276:
19: Hund (Häm): Rw. ‘Beißer’
- Seite 277 und 278:
V (Per:) Spiegel (Lama) ist zu Eis
- Seite 279 und 280:
edeutet auch Ȇberreste, Leichnam
- Seite 281 und 282:
11: Taube (Tss): lat. ‘columba’
- Seite 283 und 284:
Candide Während die Hellschreiber
- Seite 285 und 286:
und der Helle; sie entrückte ihre
- Seite 287 und 288:
Utopia Der Tag (Cl) steigt auf (eri
- Seite 289 und 290:
19: Musikant (Cl): rw. ‘Klinger
- Seite 291 und 292:
Sieg der Weichseln Daß der Donner
- Seite 293 und 294:
*»ins Hole werfen« (engl. ‘hole
- Seite 295 und 296:
16: Koffer (Vag): lat. ‘cista’
- Seite 297 und 298:
Erinnerung an die Schrecken derJuge
- Seite 299 und 300:
schmelzen«. — letzte Stunde (VV)
- Seite 301 und 302:
Anrufung des Fisches Schwimmst du (
- Seite 303 und 304:
25: Kloster (Vul): Wohnstätte für
- Seite 305 und 306:
(Cl): lat. ‘crystallus’ > *zu
- Seite 307 und 308:
Sklaven zur Strafe hinein, die stat
- Seite 309 und 310:
Schmiere«. Vgl. auch ‘Griesgram
- Seite 311 und 312:
Prozession Schrott (MB) im Maul (VV
- Seite 313 und 314:
= ‘Kotze’ (Küpper): »Überwur
- Seite 315 und 316:
Porphyr heißt nach seiner Farbe
- Seite 317 und 318:
»safranfarbiges Prachtgewand (Iri)
- Seite 319 und 320:
Assoziation: ‘basiliscus’, eine
- Seite 321 und 322:
Führungsring« (As). ‘Holz’ is
- Seite 323 und 324:
Hostess (Ut): engl. ‘hostess’
- Seite 325 und 326:
Text: Verteidigung der Wölfe, S. 8
- Seite 327 und 328:
‘roue’ »Rad« homophon mit ‘
- Seite 329 und 330:
25 Auch du auch du auch du (verschi
- Seite 331 und 332:
Lochplatte. Ein „grobes“ Raster
- Seite 333 und 334:
wendet sich dann mit einer Anrede a
- Seite 335 und 336:
etrachtet, der gegen Men draußen (
- Seite 337 und 338:
Titel: Konjunktur (GV): lat. ‘con
- Seite 339 und 340:
Verteidigung der Wölfe gegen die L
- Seite 341 und 342:
17: applaudieren (pls: Ic): Bei-Pha
- Seite 343 und 344:
Anhang 1 Schlüssel zum Totenbuch d
- Seite 345 und 346:
Anch = Cl-VS (Henkelkreuz; »Schlü
- Seite 347 und 348:
Männer« meldeten das Erscheinen d
- Seite 349 und 350:
die Beiden Ufer = Vul & Vag (PVC al
- Seite 351 und 352:
3. GP (Sei gegrüßt, du (GP-RE) in
- Seite 353 und 354:
Fähre = 1. mG (Nun) - ihr Steuerru
- Seite 355 und 356:
Frosch (männliche Gottheiten wurde
- Seite 357 und 358:
Hapi = 1. Lama (der affenköpfige S
- Seite 359 und 360:
» seine Schale = VV (RE schwimmt a
- Seite 361 und 362:
Jun = PVC (alter Fetisch: »Pfeiler
- Seite 363 und 364:
1. PVC (Osiriskrone = Weiße Krone
- Seite 365 und 366:
Maat (Göttin der Gerechtigkeit (Er
- Seite 367 und 368:
Name (»N« und »M« deuten auf Fl
- Seite 369 und 370:
Nun (als »Urgewässer«; aber auch
- Seite 371 und 372:
» Vul (der Erdgott Geb; „Ich lei
- Seite 373 und 374:
- Milchstraße = RiP (Grenzgebiet z
- Seite 375 und 376:
- Ufer = » Vul (das Wäscher-Ufer)
- Seite 377 und 378:
- sein Thron, Podium, seine Treppe,
- Seite 379 und 380:
- sein Kopf = GP / PVC (als Widder:
- Seite 381 und 382:
de (FoV). — Der von CuLax-Chemmis
- Seite 383 und 384:
als Kreis: beißt sich in den eigen
- Seite 385 und 386:
Schwein = 1. MB-Sothis (wird beim T
- Seite 387 und 388:
Du (NN als GC) strahlst wie RE im
- Seite 389 und 390:
Tatenen (»das erhabene Land«; „
- Seite 391 und 392:
Ergebnisse’ (?), m.E. besser: Er
- Seite 393 und 394:
der Überfluß, »Großer Schwarzer
- Seite 395 und 396:
- CauS = Schatten (Hals; bildliche
- Seite 397 und 398:
wohlbehalten / wohlversehen = mit S
- Seite 399 und 400:
- Fell kopflos (aper) aufgehängt a
- Seite 401 und 402:
- Schatten = Spum (der Verstorbene
- Seite 403 und 404:
Anhang 2 Kleiner Thesaurus zum Tote
- Seite 405 und 406:
Men = Reinigung, Verwesung, Umkehr
- Seite 407 und 408:
Das Volk der Kelten wird im 6. Jh.
- Seite 409 und 410:
noch haben. Verraten sie vielleicht
- Seite 411 und 412:
Baum ersetzt.) Die fünf Vokale leg
- Seite 413 und 414:
Figur, die jetzt aussieht wie das o
- Seite 415 und 416:
Schlauchpilz (Mix) verursachten »U
- Seite 417 und 418:
engl. ‘flour’ »Mehl« ist homo
- Seite 419 und 420:
ist aber »4« und gibt einen deutl
- Seite 421 und 422:
(PVC) geweiht und ist ein Symbol de
- Seite 423 und 424:
(Weihnachten)« 138 von 1504 abgebi
- Seite 425 und 426:
Versehentlich tötete er ihn mit se
- Seite 427 und 428:
UND dem Holz der männlichen wilden
- Seite 429 und 430:
vom Alten Tropfenden Haselstrauch,
- Seite 431 und 432:
Gespenst (VVaper) oder Lepra (Mix p
- Seite 433 und 434:
östlichen Mittelmeerraum (Vag) wie
- Seite 435 und 436:
die Mistelvariante Loranthus bei un
- Seite 437 und 438:
Herbst Westen Anhang 4.1 Nordische
- Seite 439 und 440:
erfinder auf beide Vorstellungen R
- Seite 441 und 442:
14. Laugr: Glück (Mix): Heimkehr d
- Seite 443 und 444:
Wassermann / Saturn / Blase / Janua
- Seite 445 und 446:
Faulmann sagt einmal: Die Bedeutung
- Seite 447 und 448:
Anhang 5.2 Anatomie und Himmelsschr
- Seite 449 und 450:
Tafel Anhang 5.1 »Himmelsschriften
- Seite 451 und 452:
Anhang 6 HKW-Ringe und Tarot-Bildgr
- Seite 453 und 454:
man zu jedem Zeichen des HKW-22 noc
- Seite 455 und 456:
könnte: »Rad« und »Welt« marki
- Seite 457 und 458:
phönikischen Buchstaben, die wir a
- Seite 459 und 460:
hängende Girlande in den vom Galge
- Seite 461 und 462:
Anhang 7 Das HKW als Geheimtextschl
- Seite 463 und 464:
Dazu schreibt man drei bestimmte Ve
- Seite 465 und 466:
Autodidakten) und unten mit hebräi
- Seite 467 und 468:
gleiche muß also derselbe vom Anfa
- Seite 469 und 470:
Klartext + Zeile 1 + Zeile 2«; dan
- Seite 471 und 472:
462 „Mittelminoisches Siegel, das
- Seite 473 und 474:
147f. 37 Chicago (Dinner), S. 100.
- Seite 475 und 476:
1173. 212 Ebd., S. 935. 213 Ebd., S
- Seite 477 und 478:
Walker, S. 202. 307 Bellinger (Himm
- Seite 479 und 480:
Kahir, S. 167. 384 Ebd., S. 210. 38
- Seite 481 und 482:
S. 557f. 22 Brockhaus. 23 Zit. nach
- Seite 483 und 484:
Ranke (Göttin), S. 190. 24 Ranke (
- Seite 485 und 486:
Bischoff, Erich: Mystik und Magie d
- Seite 487 und 488:
aller Zeiten und aller Völker des
- Seite 489 und 490:
König, Marie E.P.: Am Anfang der K
- Seite 491 und 492:
Singh, Simon: Geheime Botschaften.
- Seite 493:
Abb. 10]; S. 252 [> Taf. 12.4: Abb.