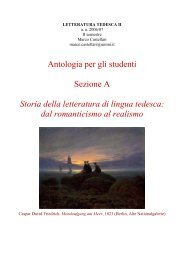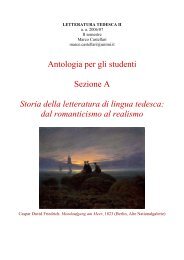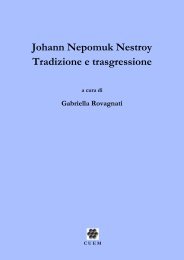Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
138 Das Leben in den Worten ~ <strong>di</strong>e Worte im Leben<br />
beurteilen, zu klassifizieren, zu definieren innerhalb einer Ordnung, eines<br />
Systems – eben aus Sprache konstituiert –, ist nicht imstande, und will es<br />
vielleicht auch nicht, dem wirklichen Leben gerecht zu werden:<br />
»[...] Erlebnisse? Schicksale? Leiden? Qualen? Pein, Irrtümer, <strong>di</strong>e<br />
BEZAHLT werden, erlitten werden; wahrscheinlich, denkbar ist es<br />
gewiß, ›mache‹ ich gewisse ›Lebensläufe‹ wieder zum Erlebnis? [...]« 12<br />
Was und wie viel weiß <strong>di</strong>e Autorin von den erlittenen und bezahlten Erlebnissen,<br />
Schicksalen, Leiden, <strong>di</strong>e in ihrem Werk reproduziert werden? Wie geht<br />
sie vor beim Schreiben? Sicher ist sie nicht nur durch eine poetische Einbildungskraft<br />
beeinflusst, sicher hört sie zu, sieht zu, was sich hinter den<br />
Worten versteckt, was das Soziale betrifft, das sich in der Sprache manifestiert,<br />
und im Text wiederhergestellt wird, in den verschiedenen Diskursen<br />
der verschiedenen Figuren.<br />
In <strong>di</strong>esem Sinne – wie Konstanze Fliedl betont – hat Marie-Thérèse<br />
Kerschbaumer „Frauenliteratur“ realistisch, ganz pragmatisch definiert:<br />
»[...] als Fähigkeit weiblicher Schriftsteller, gerade wegen der miserablen<br />
Voraussetzungen ihrer Arbeit eine spezifische sprachliche Sensibilität<br />
zu entwickeln.« 13<br />
Das gilt in umgekehrter Richtung auch für <strong>di</strong>ejenigen LeserInnen, <strong>di</strong>e<br />
unter Umständen das kongenialere Publikum seien. Diese Autorinnen<br />
wollen nicht so sehr Mitleid erregen, fertige Identifikationen anbieten,<br />
sondern vielmehr <strong>di</strong>e Gefahren einer fixen Subjekt-Objekt-Machtsprache<br />
zeigen und an der Möglichkeit einer anderen Sprache arbeiten:<br />
»[...] <strong>di</strong>e noch nicht regiert hat, <strong>di</strong>e aber unsere Ahnung regiert und<br />
<strong>di</strong>e wir nachahmen.« 14<br />
12 Marianne Fritz, ebenda.<br />
13 Marie-Thérèse Kerschbaumer, Realismus oder Realismus? [1981]. In: M.T.K., Für mich<br />
hat Lesen etwas mit Fließen zu tun ... Gedanken zum Lesen und Schreiben von Literatur, Wien:<br />
Wiener Frauenverlag, 1989, S. 137 ff. Die Aussage der Autorin wird im Nachwort zum<br />
Band Österreichische Erzählerinnen von Konstanze Fliedl zitiert, <strong>di</strong>e dazu bemerkt: »Damit<br />
ist über eine besondere „Schreibweise“ nichts gesagt; nur <strong>di</strong>e ungleichen Be<strong>di</strong>ngungen des<br />
Schreibens und Lesens sind ungerührt benannt.« Konstanze Fliedl (1995), S. 238.<br />
14 Dieser Satz von Ingeborg Bachmann (in: Ingeborg Bachmann, Werke. Hrsg. von<br />
Christine Koschel, Inge von Weidenbaum u. Clemens Münster, 4 Bde, München: Piper,<br />
1978, Bd. IV, S. 270) ist im Nachwort von Konstanze Fliedl zitiert. – Vgl. dazu <strong>di</strong>e Formulierung<br />
von Konstanze Fliedl, <strong>di</strong>e auf <strong>di</strong>e Gefahr der Machtsprache hinweist: »Sprache<br />
ist ein Instrument, das seine eigenen Beschä<strong>di</strong>gungen vorzeigt; sie ist belangbar. Wenn sie