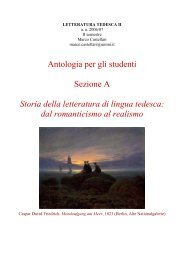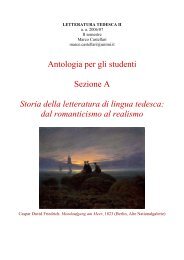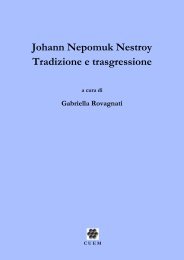Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18 Das Leben in den Worten ~ <strong>di</strong>e Worte im Leben<br />
Erst später wurden <strong>di</strong>e zwei hier <strong>di</strong>alektisch verknüpften Teile des Rationalen<br />
und Nicht-Rationalen getrennt, und seit Aristoteles wurde der<br />
Begriff des Logos auf den Bereich der rein theoretischen Erkenntnis beschränkt.<br />
So verlor das Nicht-Rationale, das Materielle, das Sinnlich-<br />
Triebhafte an Wert und Bedeutung, zumindest für das Denken, und der<br />
einseitig rationale Begriff des Logos wurde allmählich – immer schärfer<br />
und intoleranter – vom in abwertender Bedeutung aufgefassten Mythos abgegrenzt.<br />
Ein neues Interesse für den sich dem rationalen Diskurs entziehenden<br />
Mythos zeigte sich in der deutschen Frühromantik, in den Schriften<br />
Herders und Schlegels, <strong>di</strong>e ihm wieder eine entscheidende Rolle in der<br />
Poetik und in der Politik zuerkannten.<br />
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dann eine philosophische<br />
Richtung entwickelt, <strong>di</strong>e weder Logos noch Mythos abwertete, sondern<br />
sich auf das Leben als umfassendes Grundprinzip berief. Für Henri<br />
Bergson war das Leben ein dauernder schöpferischer Prozess, getragen<br />
vom Lebensimpuls (Élan vital). Die oft reduktionistisch verwendeten Gegensätze<br />
der Emotio und der Ratio, des Logos und des Mythos, des Sinnlichen<br />
und des Rationalen fanden hier eine Versöhnung:<br />
»Charakteristisch [für <strong>di</strong>e Lebensphilosophie] ist <strong>di</strong>e Betonung einer<br />
intuitiven Erkenntnismöglichkeit, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e partielle Verstandeserkenntnis<br />
übersteigt, des Werdens vor dem statischen Sein, einer<br />
ganzheitlichen Sicht des Menschen gegen eine reduktionistische<br />
technisch-wissenschaftliche Perspektive.« 5<br />
Wie Marlene Streeruwitz in Bezug auf Initiationsriten (aus denen <strong>di</strong>e<br />
Frauen zweifellos ausgeschlossen sind) bemerkt, ist es wichtig für <strong>di</strong>e Erkenntnis,<br />
sich auf andere Zeitrahmen und andere Realitätsformen zu beziehen,<br />
um später zu sich selbst zurückzukehren:<br />
»In steter Wiederholung und Neueroberung richten wir <strong>di</strong>esen Blick<br />
auf uns selbst. In uns selbst. Oder versuchen jedenfalls, <strong>di</strong>esen Blick<br />
zu lernen. Und anzuwenden. Auch bei uns sind es <strong>di</strong>e Älteren, <strong>di</strong>e<br />
uns unterweisen. Die <strong>di</strong>esen Blick zulassen. Oder verweigern.« 6<br />
Kultur und Literatur ermöglichen dem Leser/der Leserin, sich <strong>di</strong>ese<br />
Perspektiven, <strong>di</strong>ese Blicke anzueignen, durch <strong>di</strong>e Vermittlung der Älteren,<br />
5 Metzler Philosophie Lexikon (1999), S. 319-320.<br />
6 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen,<br />
Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1997, S. 8.