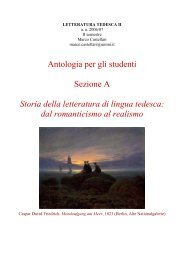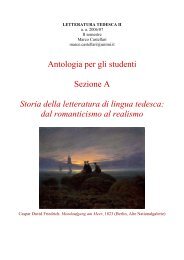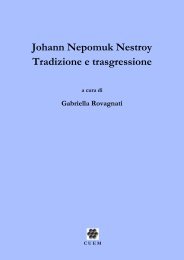Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 143<br />
schweige denn Kinder großziehen« kann, wird in den letzten Phasen des<br />
Krieges sinnlos sterben und wird sich weder um den eigenen Sohn noch<br />
um <strong>di</strong>e geliebte Berta kümmern können.<br />
Wilhelmine ist nicht Berta: so ist der erste Abschnitt betitelt. Aber – abgesehen<br />
von der weiblichen Endung des Namens – trägt <strong>di</strong>ese Figur männliche,<br />
allzumännliche Züge, <strong>di</strong>e sie sprachlich, durch einen für sie/ihn? typischen<br />
Diskurs ausdrückt, und wird stän<strong>di</strong>g auch mit „männlichen“ Ausdrücken<br />
von der erzählerischen Instanz beschrieben, wie im Abschnitt, der<br />
Wilhelmine unterwegs betitelt ist.<br />
»Wilhelmine war im Hof unruhig auf und ab marschiert. [...] Wilhelmine<br />
war empört, sehr empört. [...] Ihre Empörung hatte bitter Bewegung<br />
nötig, recht viel Bewegung. Erst als ihre Tatkraft zweigeteilt<br />
war auf Bewegung und Empörung, vermochten sich in ihrem Gehirn<br />
<strong>di</strong>e eher vernünftigen Gedanken durchzusetzen.« (S.V., S. 96 f.)<br />
Zu den Leuten ist sie immer entschieden und furchtbar selbstsicher,<br />
sogar zerstörerisch mit Worten und Mimik: sie wirft mal einen „vernichtenden<br />
Blick“ (auf <strong>di</strong>e Krankenschwester, S. 97), mal einen „niederschmetternden<br />
Blick“ (auf den Ehemann Wilhelm, S. 98), sie geht nicht,<br />
sondern marschiert „hocherhobenen Hauptes vorbei“ (S. 98), <strong>di</strong>e Erstarrung<br />
wird also auch in der Körpersprache signalisiert, als Metapher für ihre<br />
Stumpfsinnigkeit und ihre grausame Entschiedenheit:<br />
»Sie keuchte Treppen bergauf, bergab. Eine Hand zur Faust geballt,<br />
<strong>di</strong>e andere um <strong>di</strong>e Handtasche gekrampft.« (S.V., S. 97)<br />
In der ganzen Struktur des Textes, von <strong>di</strong>esem Anfang bis zum Ende,<br />
stellen Berta und Wilhelmine zwei entgegengesetzte Welten dar. Die eine,<br />
der Berta angehört, ist <strong>di</strong>e Welt der Phantasie, der utopische Freiraum der<br />
Illusionen, der zärtliche Bereich der Emotionen und der Gefühle, und <strong>di</strong>e<br />
zweite ist <strong>di</strong>e Welt der Starrheit, der Ordnung, der Regel, <strong>di</strong>e schrecklich<br />
nackte Dimension des Alltäglichen, <strong>di</strong>e Wilhelmine para<strong>di</strong>gmatisch und<br />
auf grotesk über<strong>di</strong>mensionierte Weise symbolisiert:<br />
»Wilhelmine war in ihrem Element. Sie mußte Ordnung schaffen, <strong>di</strong>e<br />
Verhältnisse ins rechte Lot bringen und den Unglücksraben Berta<br />
vor der Zweifel- und Grübelsucht Wilhelms in Sicherheit bringen.«<br />
(S.V., S. 98)<br />
Wenn <strong>di</strong>e Subjektivität des Einzelnen, <strong>di</strong>e Identität, nur mittels Sprache<br />
konstituiert und verhandelt werden kann, 20 so erscheint der Diskurs von<br />
20 Vgl. Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 17.