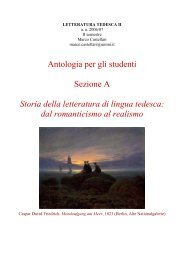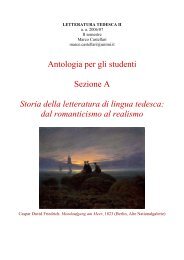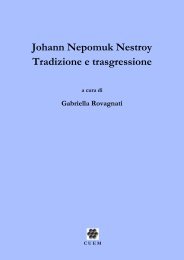Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marlene Streeruwitz: Eine Poetik des Suchens 235<br />
Der erste Satz gibt natürlich in der Sie-Form <strong>di</strong>e Wertung Lisas wieder,<br />
der zweite und der dritte Satz reproduzieren den Diskurs der Mutter als<br />
Tatsache im In<strong>di</strong>kativ, als Teil der Erzählebene. Freier kann <strong>di</strong>e Interpretation<br />
des vierten Satzes sein, <strong>di</strong>e wahrscheinlich einem Gedanken Lisas<br />
entspricht.<br />
Exemplarisch erfolgt <strong>di</strong>eses Verfahren im Roman Nachwelt., der durch<br />
einen konstanten, strukturellen Rekurs auf <strong>di</strong>e Heteroglossie charakterisiert<br />
ist, indem der Text grundsätzlich so viele Stimmen wie möglich referieren<br />
will:<br />
»Man verlöre <strong>di</strong>e Zeit. Jeder Tag sei wie der andere. Die beiden<br />
Frauen neben ihr nickten. Sie solle sie anschauen. Sie und ihre<br />
Freun<strong>di</strong>nnen. Sie wären so alt geworden und hätten alle drei keine<br />
Ahnung, wohin ihr Leben verronnen wäre. Margarethe lachte. Kalifornien<br />
sei doch der Traum von allen. Nein. Nein. Schüttelte <strong>di</strong>e<br />
Frau den Kopf. Warum sie dann nicht wegzögen, fragte Margarethe.<br />
Für sie sei es zu spät, sagte <strong>di</strong>e Frau. Sie wären hiergekommen und<br />
dann immer hiergeblieben.« (Nachwelt., S. 398-399)<br />
Das Verfahren der Heteroglossie setzt Achtung für <strong>di</strong>e Aussagen und<br />
<strong>di</strong>e Einstellungen der anderen voraus und entspricht also einer ethischen<br />
Haltung: «Eine bewusste Akzeptanz der Heteroglossie unserer Welt impliziert<br />
eine selbstreflexive Interpretation, <strong>di</strong>e eine <strong>di</strong>alogische, nie abzuschließende<br />
Interaktion zwischen Autor, Text, Leser und Kontext(en) anstrebt.»<br />
97<br />
»Sie mußte Gregor verklagen. [...]. Aber Gregor hatte ihr gedroht. Er<br />
würde sie fertigmachen, unternähme sie etwas derartiges. Die Kinder<br />
würde sie nicht behalten, hatte er gedroht.« (Verf., S.103)<br />
Wenn jetzt <strong>di</strong>eselbe Textpassage aus dem Roman Verführungen. wiedergelesen<br />
wird, kann man/frau beobachten, dass <strong>di</strong>e so oft kritisierte Verwendung<br />
des Konjunktivs dazu <strong>di</strong>ent, <strong>di</strong>e Diskurse der Figuren in den<br />
Text einzunähen, mit dem Verweis auf einen von den russischen Formalisten<br />
geprägten Begriff „Skaz“, womit eine am mündlichen Erzählen orientierte<br />
Erzählweise definiert wird, <strong>di</strong>e lebhaft und spontan erscheint. Typische<br />
stilistische Merkmale vom Skaz sind Dialekt, Soziolekt, Slang, I<strong>di</strong>osynkrasien<br />
in Grammatik oder Aussprache. Der Begriff wurde innerhalb<br />
der russischen formalistischen Literaturtheorie entwickelt: V. Vinogradov<br />
97 Vgl. dazu den zitierten Artikel im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie<br />
(1998), S. 211.