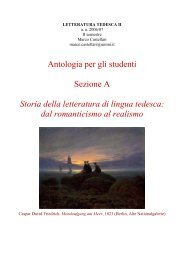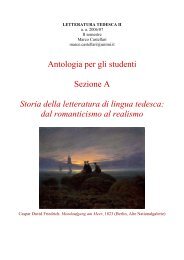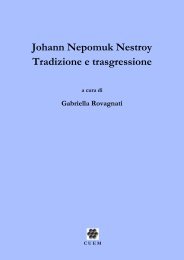Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 185<br />
verstimmt. Ich kann sie nicht stimmen, und du hast keinen Musiklehrer,<br />
der sie <strong>di</strong>r stimmen kann. Laß das.« (S.V., S. 95-96)<br />
c) Wiederholung umfangreicher Textteile, <strong>di</strong>e leitmotivisch wiederkehren:<br />
dabei wird »Information nicht nur ein einziges Mal transponiert, sondern<br />
wird zum sich wiederholenden ästhetischen Phänomen.«<br />
d) Lexikalische Selektion, wodurch sich <strong>di</strong>e innere Vielsprachigkeit<br />
konstituiert.<br />
Wie Bettina Rabelhofer in Bezug auf den Roman bemerkt, ist <strong>di</strong>e<br />
Kommunikationssituation der Sprechenden sicher nicht mit jener der<br />
Autorin selbst identisch. Sie weist vielmehr auf einen komplexen Entscheidungsprozess<br />
hin:<br />
»Durch <strong>di</strong>e Eingliederung ‚fremder‘ Elemente aus einem anderen<br />
Register, einem anderen Sozio- oder Dialekt in den Text schöpft<br />
Fritz (pragma)semantisches Potential auf vielen Sprachebenen bestmöglich<br />
aus.« 62<br />
Obwohl der Wortschatz der ersten Erzählung von Marianne Fritz<br />
grundsätzlich aus dem Gebrauchsvokabular alltagssprachlicher Interaktion<br />
(eines bestimmten sozio-historischen Umfeldes) besteht, kann auch zu<br />
<strong>di</strong>esem Text bemerkt werden, dass öfter „Poesie-Signale“ auftauchen, <strong>di</strong>e<br />
einen ironischen Kontrast bilden durch <strong>di</strong>e stilistische Vielfalt, <strong>di</strong>e den<br />
Roman bestimmt.<br />
Die Erzählung bezeugt <strong>di</strong>e Bemühung der „Namenlosen“, sich und den<br />
eigenen Kindern ein höheres Sprachniveau anzueignen. Die arme Berta<br />
versucht zu verhindern, dass der Knabe Rudolf umgangssprachliche<br />
Redensarten verwendet: <strong>di</strong>e verbale Form „purzlt“ anstatt des üblichen<br />
Partizips „geboren“, aus dem Verb „purzeln“ (fallen, hinfallen, stürzen,<br />
besonders von Kindern). Nach der etymologischen Herkunft (‹spätmhd.<br />
„burzeln“) erinnert das Verb den Lesenden an eine Definition von Rudolf,<br />
Klein-Rudolfs Vater. Der Geliebte Bertas behauptet in Bezug auf <strong>di</strong>e mit<br />
dem Mädchen verbrachte Liebesnacht, es schien ihm „mit einem Bürzel“<br />
geschlafen zu haben.<br />
Wenn Berta ihren Kindern von der Oma erzählt, benutzt sie <strong>di</strong>e adverbiale<br />
Formel „justament grad“, <strong>di</strong>e aus der ungewöhnlichen Verbindung<br />
von zwei Teilen besteht, welche „gerade“, „genau“ bedeuten: der<br />
62 Bettina Rabelhofer, So es geraunt rundumihn: der ästhetische Code in Marianne Fritz’ Roman<br />
„Dessen Sprache du nicht verstehst“. Versuch einer semiotischen Poetik, Erlangen: Palm und<br />
Enke, 1991, S. 37-38.