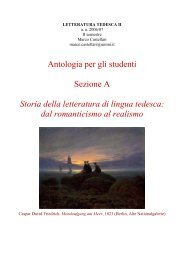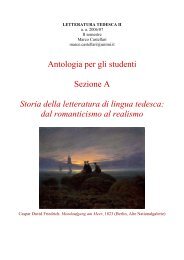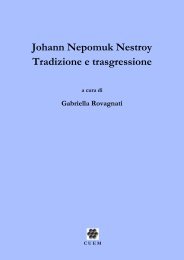Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
234 Das Leben in den Worten ~ <strong>di</strong>e Worte im Leben<br />
»Sprachliche Zeichen [...] sind nicht nur linguistisch (wie durch Dialekte,<br />
Soziolekte, I<strong>di</strong>olekte usw.) geprägt, sie sind darüber hinaus<br />
eingebettet in einen politischen, moralischen, ideologischen und<br />
ökonomischen Kontext miteinander konkurrierender Episteme.« 96<br />
So möchte ich behaupten, dass <strong>di</strong>e Texte Marlene Streeruwitz’ (aber<br />
auch <strong>di</strong>e der beiden Autorinnen Evelyn Schlag und Marianne Fritz, trotz<br />
der thematischen und sprachlichen Unterschiede) sich als <strong>di</strong>alogische Literatur<br />
erweisen: während monologische Texte <strong>di</strong>e soziale Redevielfalt homogenisieren<br />
und autoritär auf eine dominante Stimme einengen, ist polyphonische<br />
Literatur demokratisch, indem sie Meinungsvielfalt widerspiegelt.<br />
Die Heteroglossie reduziert natürlich <strong>di</strong>e Welt im Werk durch semantische<br />
(d. h. durch <strong>di</strong>e Wortwahl) und syntaktische (hier durch <strong>di</strong>e Parataxe<br />
und <strong>di</strong>e Ellipse) Selektion und durch <strong>di</strong>e narrative Struktur.<br />
Im Roman Verführungen. wird <strong>di</strong>e narrative Struktur zwar von der Perspektive<br />
der Hauptfigur Helene entwickelt, aber im textuellen Umfeld tauchen<br />
immer wieder <strong>di</strong>e Stimmen der Anderen auf, und das erlaubt gerade<br />
<strong>di</strong>e freie erlebte Rede:<br />
»Professor Sölders sagte Helene <strong>di</strong>ese Sätze, als wäre sie ein liebes<br />
kleines Kind und müßte unterwiesen werden. Gedul<strong>di</strong>g dozierte er<br />
vor sich hin. Die dunkelhaarige Frau kam herein. Ob der Professor<br />
etwas bräuchte? Lächelnd verneinte der Mann und fuhr fort. Helene<br />
füllte 7 Seiten mit seinen Aussprüchen. Sie bedankte sich für <strong>di</strong>e<br />
Mühe, <strong>di</strong>e er sich gemacht hatte.« (Verf., S. 47)<br />
In <strong>di</strong>eser einzigen Passage ist es möglich, drei Stimmen zu „hören“: <strong>di</strong>e<br />
des Professors, <strong>di</strong>e der zuhörenden Helene, mit welcher sich der Leser/<strong>di</strong>e<br />
Leserin identifizieren kann, und <strong>di</strong>e der dunkelhaarigen Frau.<br />
Auch im Roman Lisa’s Liebe. werden <strong>di</strong>e Aussagen der anderen auf der<br />
erzählerischen Ebene wiedergegeben und es kommt auf den Leser/<strong>di</strong>e<br />
Leserin an, <strong>di</strong>e Konnotationen und <strong>di</strong>e Wirkung <strong>di</strong>eser ursprünglich ausgesprochenen<br />
und dann im Gedächtnis Lisas gespeicherten Sprechakte zu<br />
rekonstruieren:<br />
»Ihre Mutter war immer ungnä<strong>di</strong>g gewesen. Lisa hatte es nicht richtig<br />
machen können. Daran war nichts zu ändern gewesen. Lisas Mutter<br />
wollte Männer.« (L. L., 1. Folge., S. 91)<br />
96 Vgl. dazu den Artikel über „Heteroglossie“ im Band Metzler Lexikon Literatur- und<br />
Kulturtheorie (1998), S. 211.