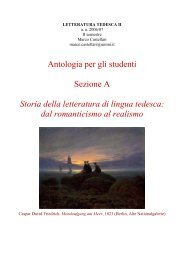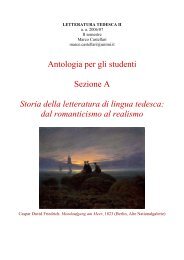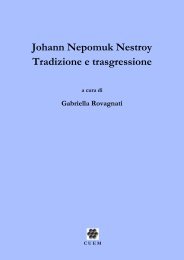Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marlene Streeruwitz: Eine Poetik des Suchens 237<br />
Was gibt ihr <strong>di</strong>e Kraft, sich der allgemeingültigen Wahrheit zu widersetzen?<br />
Helene schöpft ihre Lebenskraft, ihren Lebenswillen aus der Beziehung<br />
zu den Kindern, indem sie <strong>di</strong>e Mütterlichkeit nicht als Stereotyp<br />
erfährt, sondern deren „Richtigkeit“ im inneren Monolog besagt:<br />
»Helene schwang <strong>di</strong>e Beine auf <strong>di</strong>e Brüstung. Sie stand auf der Brüstung.<br />
[...] Dann sprang sie auf den Weg. Sie konnte nicht kün<strong>di</strong>gen.<br />
Es war nicht falsch gewesen. Es war nicht unrichtig gewesen. Es war<br />
richtig gewesen. Diese Kinder waren richtig. Und sie hatte es richtig<br />
gemacht. Helene ging eine große Wiese entlang.« (Verf., S. 103)<br />
Das sprachliche Benehmen Gregors, der sich teilweise brutal ausdrückt,<br />
sich meistens aber verleugnen lässt, es sogar ablehnt, mit Helene zu<br />
telefonieren, verletzt Helene im Innersten und unterbricht ihre Versuche,<br />
mit ihm zu kommunizieren.<br />
»Sie wolle es kurz machen, sagte Helene zu Gregor. Aber. [...] Helene<br />
kam in Schwung. Ob Gregor wisse, wie hoch verschuldet er sei. Bei<br />
ihr. Und den Kindern. Gregor unterbrach Helene. Ja. Ja. Sie würde<br />
von seinem Anwalt hören.« (Verf., S. 112).<br />
Da taucht wieder der Versuch auf, Frauen zum Schweigen zu bringen,<br />
indem ihnen <strong>di</strong>e Rolle als Gesprächspartner verweigert wird: <strong>di</strong>ese Strategie<br />
entspricht der körperlichen Gewalt, <strong>di</strong>e Helene als Kind erfahren<br />
musste. Als Erwachsene hat sie jetzt aber kaum Hoffnung mehr auf eine<br />
bessere Existenz, wegen der vielen Probleme und wegen der emotionellen,<br />
ja existentiellen Gewalt, <strong>di</strong>e sie von Gregor erlitten hat:<br />
»Und sie dürfte öffentlich weinen. Aber. Es war nichts anders geworden.<br />
Nichts verändert. Nichts hatte sich geändert. Helene hatte<br />
oft wochenlang nicht schwimmengehen können. Oder mitturnen.<br />
Wegen der blauen Flecken auf Armen und Schenkeln. Wenn der<br />
Vater sie. Niemand hatte davon erfahren dürfen. Davon. Dafür hatte<br />
es immer extra Schläge gegeben. Sie hatte immer nur heimlich weinen<br />
dürfen. Und jetzt. Jetzt war überhaupt alles verwehrt. Nicht nur<br />
das Schwimmbad. Oder eine Turnstunde. Jetzt war es das Leben.<br />
Das ganze Leben.« (Verf., S. 112-113)<br />
Am Beispiel <strong>di</strong>eses Textausschnittes kann der Leser/<strong>di</strong>e Leserin ohnehin<br />
verstehen, wie wichtig <strong>di</strong>e Lakonie, <strong>di</strong>e Ellipse, <strong>di</strong>e Aposiopese sind,<br />
wie unentbehrlich <strong>di</strong>e Stille, <strong>di</strong>e Pause, der Punkt, um das Unsagbare zu<br />
evozieren, um »[...] dem Unsagbaren zur Erscheinung zu verhelfen«. Im<br />
Innersten weigert sich das Ich Helenes <strong>di</strong>e Gewalttaten des Vaters sich