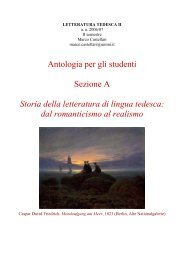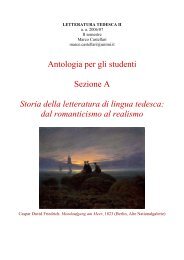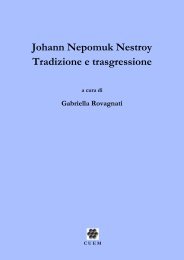Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 157<br />
Das <strong>di</strong>chte Netz <strong>di</strong>eser Ausdrücke bildet eine Vorrichtung zur Abwehr<br />
gegen <strong>di</strong>e Gefahren der Umwelt, gegen <strong>di</strong>e übertriebenen Erfordernisse<br />
seines Brotgebers, gegen das Unbehagen Bertas und später gegen <strong>di</strong>e unaufhörlichen<br />
Ehe<strong>di</strong>spute mit Wilhelmine.<br />
»Sein Weib, <strong>di</strong>e resolute Wilhelmine, fühlte sich stets verantwortlich<br />
für den letzten Beitrag zum Ehe<strong>di</strong>sput, da sie auf alles <strong>di</strong>e unerläßliche<br />
Antwort wußte, <strong>di</strong>e den Gesprächspartner Wilhelm widerlegte.«<br />
(S. V., S. 10)<br />
Erst entscheidende Ereignisse oder unakzeptables Benehmen können<br />
ihn aus <strong>di</strong>esem Netz vorläufig verhelfen:<br />
»Da wurde Wilhelm zum Manne; alle Zweifel- und Grübelsucht war<br />
von ihm abgefallen; er hielt Wilhelmine am Ärmel fest und sagte:<br />
›Das kommt nicht in Frage. Das duld ich nicht.‹ « (S.V., S. 19)<br />
Im Allgemeinen aber begnügt er sich, den Behauptungen seines Weibes<br />
nicht zu widersprechen: beim Disputieren beschränkt er sich absichtlich<br />
„auf <strong>di</strong>e Rolle des Verlierers“ und bemüht sich, besonders „gleichmütig<br />
und sanftgestimmt“ zu wirken, was auch sein Äußeres bestimmt, in der<br />
vorfingierten „friedlichen Bescheidenheit“ (S.V., S. 10), <strong>di</strong>e zu einer provisorischen<br />
Ruhe beitragen soll, aber ihm sicher kein Eheglück schenken<br />
kann. Dazu <strong>di</strong>enen auch <strong>di</strong>e Kosenamen, <strong>di</strong>e er mit Rekurs auf eine emphatische<br />
Aufzählung anwendet, um <strong>di</strong>e Maskulinität seines Weibs zu beschwören,<br />
Kosenamen, <strong>di</strong>e für den Leser/<strong>di</strong>e Leserin in Anbetracht der<br />
Umstände, also im Rahmen des textuellen Umfelds, etwas komisch klingen<br />
und <strong>di</strong>e Ironie der erzählerischen Instanz (durch <strong>di</strong>e Präsenz des Ausrufezeichens<br />
markiert) auch realisieren:<br />
» ›Mein Goldmäderl! Mein tüchtiges Wilmerl [...] Bei allen Heiligen<br />
(!), mein Tauberl, mein Ehrenwort als Chauffeur. [...] Erfüllen will ich<br />
all deine Wünsche, eh du sie ausgesprochen hast. Du herziges<br />
Wilmerl, du fleißiges Bienderl, du über alle Zweifel erhabene Geliebte!<br />
[...]‹ « (S.V., S. 14)<br />
Der Leser/<strong>di</strong>e Leserin weiß aber, dass Wilhelm umsonst versucht, sich<br />
selbst zu täuschen: er wird nie glücklich sein, wie Wilhelmine bei seinem<br />
Unbehagen „in<strong>di</strong>rekt“ prophezeit:<br />
» ›[...] Wart nur, bis der Regen kommt, dann fühlst du <strong>di</strong>ch gleich<br />
besser. Mußt doch nicht gleich jedesmal sterben‹.« (S.V., S. 24)<br />
Im Unbewussten Wilhelms wirkt das Verb erhellend und orakelhaft: