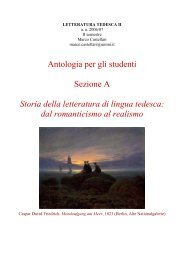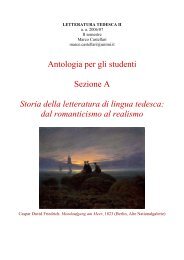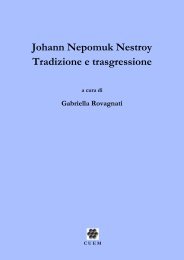Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
74 Das Leben in den Worten ~ <strong>di</strong>e Worte im Leben<br />
Dank der Empfindlichkeit solcher Figuren wird also klar, behauptet<br />
von Braun, dass <strong>di</strong>ese Formen, <strong>di</strong>e negativ als „Hysterie“ bezeichnet werden,<br />
hingegen einen besonderen geistigen Reichtum anzeigen. Die so genannte<br />
„psychische Bisexualität“, <strong>di</strong>e der männlichen wie der weiblichen<br />
Hysterie eigen sei, drückt das Bewusstsein aus, dass das ich gespalten ist<br />
und zwei oder mehrere Komponenten haben kann. Diese Gespaltenheit<br />
des Ichs ist aber eher als ein positives Element zu bewerten, weil »seine<br />
„Unvollstän<strong>di</strong>gkeit“ eben darin besteht, auch den anderen in sich zu verspüren«.<br />
55 Die Sensibilität des Protagonisten von Evelyn Schlags Erzählung<br />
soll in <strong>di</strong>esem Sinn interpretiert werden: <strong>di</strong>ese männliche Hysterie ist<br />
sicher auch als das Ersticken an der Mutter bzw. an der Realität, an dem<br />
ICH (»das kein ich neben sich duldet«) zu verstehen, welches <strong>di</strong>e weibliche<br />
Komponente in dem männlichen Bewusstsein unterdrückt. Die sprachlichen<br />
Symptome <strong>di</strong>eser Hysterie nennt man Sprachkörper: wie das Wort, das<br />
im Anfang steht, stellt auch <strong>di</strong>e Hysterie durch <strong>di</strong>e Sprachkörper <strong>di</strong>e Verwandlung<br />
von Worten in eine körperliche, mit den Sinnen wahrnehmbare<br />
Realität dar. 56 Natürlich spielt <strong>di</strong>e komplexe Beziehung zur eigenen Mutter<br />
eine gewisse Rolle beim Entstehen der männlichen Hysterie, wie auch in<br />
der Erzählung explizit erwähnt wird:<br />
»Was ist verrückter, dachte er, sich gesund zu glauben oder krank zu<br />
sein, oder das andere?«<br />
Gleich danach kommt das Zitat, das <strong>di</strong>e vorwurfsvollen Worte der<br />
Mutter reproduziert:<br />
»Die Männer sind alle Hypochonder, so <strong>di</strong>e Mutter.« (BR, S. 44)<br />
Was bleibt uns aber anderes übrig, reflektiert der Protagonist weiter.<br />
Wenn sich <strong>di</strong>e Männer <strong>di</strong>e Empfindungen verboten haben, so darf etwas<br />
„Psychisches“ nicht in Frage kommen, obwohl man das Unbehagen als<br />
somatische Symptome sichtbar macht. Nur das wird aber von der Gesellschaft<br />
akzeptiert:<br />
»Ein Magengeschwür darf man haben, der Streß darf dran schuld<br />
sein, aber keiner nimmt den Streß beim Wort.« (BR, S. 45)<br />
55 Christina von Braun (1994), S. 326.<br />
56 Vgl. Christina von Braun (1994), S. 85, den Begriff hat <strong>di</strong>e Autorin von Hans-Jürgen<br />
Heinrichs übernommen. Siehe Hans-Jürgen Heinrichs, Sprachkörper. Zu Claude Lévi-<br />
Strauss und Jacques Lacan, Frankfurt/M., Paris: Qumran Verlag, 1983.