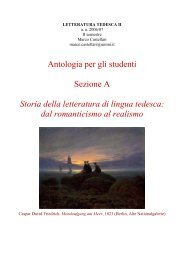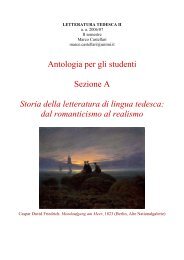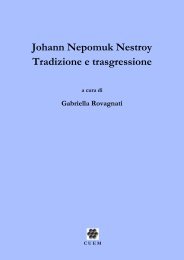Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Marlene Streeruwitz: Eine Poetik des Suchens 239<br />
Das können wir leicht im Alltagsleben feststellen: Wenn wir wagen, der<br />
herrschenden Meinung zu widersprechen, wenn der/<strong>di</strong>e Einzelne den Mut<br />
findet, mit Hilfe der Phantasie <strong>di</strong>e bedrückende Ordnung des Logos in<br />
Frage zu stellen, muss er/sie auch büßen, und manchmal <strong>di</strong>e Verlegenheit,<br />
wenn nicht das Unverständnis der anderen erleben, weil <strong>di</strong>e meisten es<br />
vorziehen, „auf der Seite von“ zu stehen, weil es einfacher ist, bequemer,<br />
vernünftiger und letztendlich auch vorteilhafter.<br />
Wieder zum Jahr 1957 und zu den Erinnerungen der Schriftstellerin<br />
zurück:<br />
»Und wenn nur Einzelne <strong>di</strong>esen Luxus kennen und so teuer bezahlen.<br />
Und wenn <strong>di</strong>e Vermutung, daß <strong>di</strong>e meisten ohnehin alles richtig<br />
fanden. Nicht nur hinsahen, sondern es durchaus richtig fanden, daß<br />
<strong>di</strong>e einen abgeholt wurden. Wenn nun auch eine Religion <strong>di</strong>ese einen<br />
nicht richtig findet. Und deren Abholung richtig. Eigentlich.«<br />
Mit dem Hinweis auf eine epochale Tragö<strong>di</strong>e (»Und wenn angeblich<br />
„Lebensraum“ hergestellt wurde«) betont <strong>di</strong>e Autorin <strong>di</strong>e schreckliche<br />
Anpassungsfähigkeit der Masse, <strong>di</strong>e den Einzelnen bei ihrem kühnen In-<br />
Frage-Stellen meistens nicht hilft und es auch nicht will:<br />
»Und wenn der Luxus der Empörung dann insgesamt einer Kultur<br />
gar nicht bekannt ist, dann findet er sich auch für ein kleines Mädchen<br />
im Jahr 1957 nicht.«<br />
Diese Schulerfahrungen haben sicher das kleine Mädchen im Jahre<br />
1957 geprägt: <strong>di</strong>e Tendenz der Schule, <strong>di</strong>e Ausnahmen sofort beurteilen<br />
und „therapieren“ zu lassen, taucht im Roman Verführungen. auf, in der Figur<br />
der „kleinen und zarten“ Frau Lehrerin Zöchling, <strong>di</strong>e Helene zum Gespräch<br />
eingeladen hat.<br />
»Und da gäbe es auch das Problem. Warum der Vater nicht da wäre.<br />
Sie fände es wichtig. Es handle sich schließlich um eine tiefangelegte<br />
Störung. Ihrer Meinung nach. Jedenfalls. Die weit über normale<br />
Schulschwierigkeiten hinausginge. Helene erschrak. Sie fühlte sich<br />
sofort schul<strong>di</strong>g. [...] Sie fühlte ein Gefühl ewiger Verdammnis. Nie<br />
wieder eine gute Minute.« (Verf., S. 42)<br />
Die Ironie der erzählerischen Instanz unterstreicht <strong>di</strong>e Achtung der<br />
Lehrerin für männliches Urteil («Warum der Vater nicht da sei.»), ihre<br />
„triumphierende“ Sicherheit beim Diagnostizieren einer „tiefangelegten<br />
Störung“.