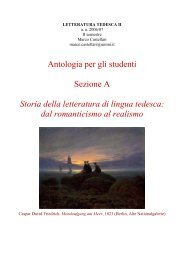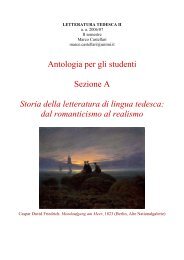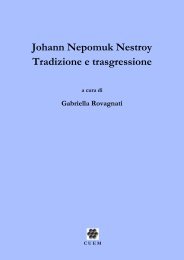Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Studia austriaca - Università degli Studi di Milano
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 141<br />
des tra<strong>di</strong>onell geformten Textes in Teile, <strong>di</strong>e den Diskurspartikeln entsprechen.<br />
Das erfolgt, indem sie <strong>di</strong>ese Teile neu kombiniert, einerseits zur poetischen<br />
Demonstration der Kraft, welche der subjektlose Diskurs der Hysterie<br />
aufweisen kann im Unterschied zu der männlichen Perspektive, und andererseits<br />
zur Konstitution eines neuen, utopischen Modells des Weiblichen, das den<br />
Kampf um Vorherrschaft ablehnt und nach einer Beziehungsstruktur<br />
strebt, <strong>di</strong>e Liebe erlaubt und keine Hassgefühle kennt, dank einer Ethik der<br />
Gabe, <strong>di</strong>e nicht auf Aneignung und Besitz zielt. 19<br />
Das Stilmittel der Ironie, das den ganzen Text prägt und sich bis zur<br />
Groteske ausdehnt, betont <strong>di</strong>e künstliche Konstitution des Werkes, seine<br />
Fiktionalität, und signalisiert <strong>di</strong>e Position der Autorin, <strong>di</strong>e rekonstruiert<br />
werden kann, und zwar von den sprachlichen Strukturen her, <strong>di</strong>e stän<strong>di</strong>g<br />
wiederholt werden, von der Anordnung des Materials her, wie sie uns aus<br />
der schriftlichen Disposition erscheint.<br />
3.2. Wilhelmine oder Wilhelm? Weiblich oder männlich? Eine Rekonstruktion<br />
der Geschlechtsidentitäten aufgrund des Diskurses als Mittel der geschlechtlichen<br />
Determination<br />
Die Geschichte von Berta Schrei, der tragischen Protagonistin der Erzählung<br />
von Marianne Fritz, der Hauptfigur, <strong>di</strong>e von den Rezensenten als<br />
„Medea in Donaublau“ bezeichnet wurde, wird im stän<strong>di</strong>gen Wechselwirken<br />
eines grundsätzlichen Dreiecks (das sind <strong>di</strong>e Figuren Berta, ihr Mann<br />
Wilhelm und ihre „Freun<strong>di</strong>n“ Wilhelmine) und drei verschiedener Zeitebenen<br />
erzählt, <strong>di</strong>e ineinander verwoben sind dank eines engmaschigen<br />
Netzes von Vorausdeutungen und Rückblenden: 1. wenn das Jahr 1945<br />
den Anfang der Geschichte darstellt, so spielt in der Zeit 1945-1958 das<br />
eigentliche Eheleben von Berta und Wilhelm, das mit dem „Befreiungsversuch“<br />
tragisch endet; 2. das Jahr 1960 wird durch <strong>di</strong>e Hochzeit Wilhelm–Wilhelmine<br />
markiert, eigentlich schon in den ersten Zeilen des<br />
Textes antizipiert; 3. <strong>di</strong>e Geschichte (und <strong>di</strong>e Erzählung) endet dann 1963,<br />
mit dem Besuch des Ehepaares Wilhelm–Wilhelmine in der Irrenanstalt<br />
zum vierzigsten Geburtstag Bertas, womit das Unglück Bertas und der<br />
Sieg Wilhelmines endgültig festgeschrieben werden. Die harmonische Ordnung,<br />
der tra<strong>di</strong>tionelle Handlungsablauf ist also zersplittert und kann aus<br />
den verschiedenen Perspektiven re-konstruiert werden, <strong>di</strong>e sich vor allem<br />
in den Diskursen der Figuren entfalten.<br />
19 Vgl. Lena Lindhoff (1995) im Kapitel zu Hélène Cixous, „Cixous: Eine andere Art<br />
der Anerkennung“, S. 122 ff.