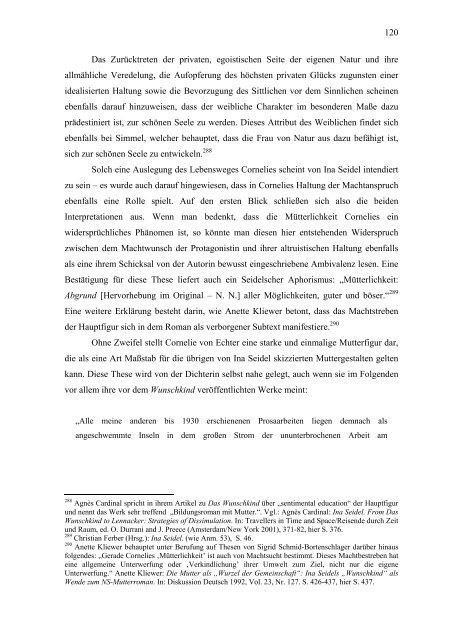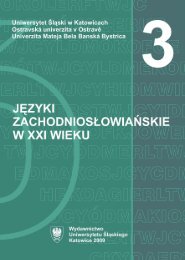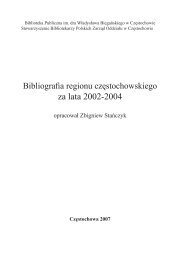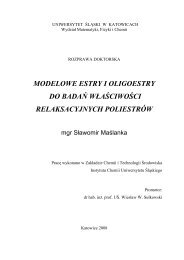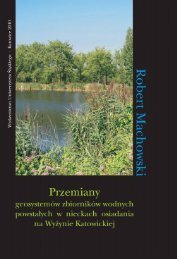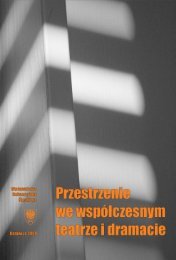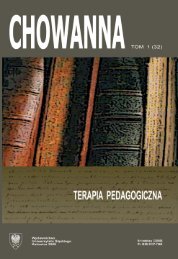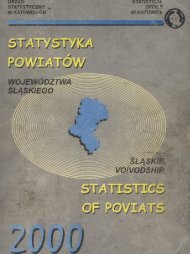Frauenbilder im Prosawerk Ina Seidels
Frauenbilder im Prosawerk Ina Seidels
Frauenbilder im Prosawerk Ina Seidels
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
120Das Zurücktreten der privaten, egoistischen Seite der eigenen Natur und ihreallmähliche Veredelung, die Aufopferung des höchsten privaten Glücks zugunsten eineridealisierten Haltung sowie die Bevorzugung des Sittlichen vor dem Sinnlichen scheinenebenfalls darauf hinzuweisen, dass der weibliche Charakter <strong>im</strong> besonderen Maße dazuprädestiniert ist, zur schönen Seele zu werden. Dieses Attribut des Weiblichen findet sichebenfalls bei S<strong>im</strong>mel, welcher behauptet, dass die Frau von Natur aus dazu befähigt ist,sich zur schönen Seele zu entwickeln. 288Solch eine Auslegung des Lebensweges Cornelies scheint von <strong>Ina</strong> Seidel intendiertzu sein – es wurde auch darauf hingewiesen, dass in Cornelies Haltung der Machtanspruchebenfalls eine Rolle spielt. Auf den ersten Blick schließen sich also die beidenInterpretationen aus. Wenn man bedenkt, dass die Mütterlichkeit Cornelies einwidersprüchliches Phänomen ist, so könnte man diesen hier entstehenden Widerspruchzwischen dem Machtwunsch der Protagonistin und ihrer altruistischen Haltung ebenfallsals eine ihrem Schicksal von der Autorin bewusst eingeschriebene Ambivalenz lesen. EineBestätigung für diese These liefert auch ein <strong>Seidels</strong>cher Aphorismus: „Mütterlichkeit:Abgrund [Hervorhebung <strong>im</strong> Original – N. N.] aller Möglichkeiten, guter und böser.“ 289Eine weitere Erklärung besteht darin, wie Anette Kliewer betont, dass das Machtstrebender Hauptfigur sich in dem Roman als verborgener Subtext manifestiere. 290Ohne Zweifel stellt Cornelie von Echter eine starke und einmalige Mutterfigur dar,die als eine Art Maßstab für die übrigen von <strong>Ina</strong> Seidel skizzierten Muttergestalten geltenkann. Diese These wird von der Dichterin selbst nahe gelegt, auch wenn sie <strong>im</strong> Folgendenvor allem ihre vor dem Wunschkind veröffentlichten Werke meint:„Alle meine anderen bis 1930 erschienenen Prosaarbeiten liegen demnach alsangeschwemmte Inseln in dem großen Strom der ununterbrochenen Arbeit am288 Agnès Cardinal spricht in ihrem Artikel zu Das Wunschkind über „sent<strong>im</strong>ental education“ der Hauptfigurund nennt das Werk sehr treffend „Bildungsroman mit Mutter.“. Vgl.: Agnès Cardinal: <strong>Ina</strong> Seidel. From DasWunschkind to Lennacker: Strategies of Diss<strong>im</strong>ulation. In: Travellers in T<strong>im</strong>e and Space/Reisende durch Zeitund Raum, ed. O. Durrani and J. Preece (Amsterdam/New York 2001), 371-82, hier S. 376.289 Christian Ferber (Hrsg.): <strong>Ina</strong> Seidel. (wie Anm. 53), S. 46.290 Anette Kliewer behauptet unter Berufung auf Thesen von Sigrid Schmid-Bortenschlager darüber hinausfolgendes: „Gerade Cornelies ‚Mütterlichkeit’ ist auch von Machtsucht best<strong>im</strong>mt. Dieses Machtbestreben hateine allgemeine Unterwerfung oder ‚Verkindlichung’ ihrer Umwelt zum Ziel, nicht nur die eigeneUnterwerfung.“ Anette Kliewer: Die Mutter als „Wurzel der Gemeinschaft“: <strong>Ina</strong> <strong>Seidels</strong> „Wunschkind“ alsWende zum NS-Mutterroman. In: Diskussion Deutsch 1992, Vol. 23, Nr. 127. S. 426-437, hier S. 437.