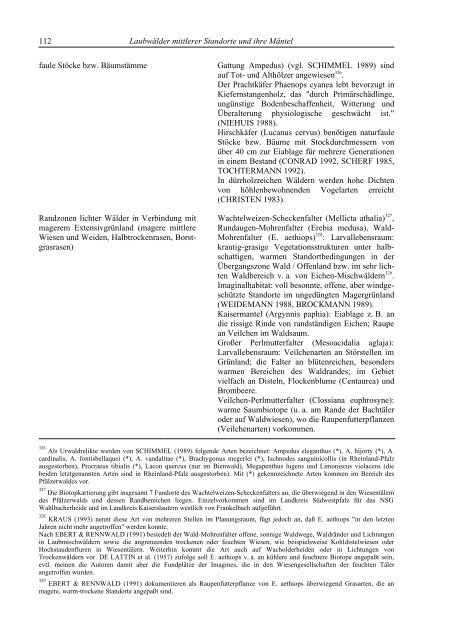Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
112 Laubwälder mittlerer Standorte und ihre Mäntel<br />
faule Stöcke bzw. Bäumstämme Gattung Ampedus) (vgl. SCHIMMEL 1989) sind<br />
auf Tot- und Althölzer angewiesen 326 .<br />
Der Prachtkäfer Phaenops cyanea lebt bevorzugt in<br />
Kiefernstangenholz, das "durch Primärschädlinge,<br />
ungünstige Bodenbeschaffenheit, Witterung und<br />
Überalterung physiologische geschwächt ist."<br />
(NIEHUIS 1988).<br />
Hirschkäfer (Lucanus cervus) benötigen naturfaule<br />
Stöcke bzw. Bäume mit Stockdurchmessern von<br />
über 40 cm zur Eiablage für mehrere Generationen<br />
in einem Bestand (CONRAD 1992, SCHERF 1985,<br />
TOCHTERMANN 1992).<br />
In dürrholzreichen Wäldern werden hohe Dichten<br />
von höhlenbewohnenden Vogelarten erreicht<br />
(CHRISTEN 1983).<br />
Randzonen lichter Wälder in Verbindung mit<br />
magerem Extensivgrünland (magere mittlere<br />
Wiesen und Weiden, Halbtrockenrasen, Borstgrasrasen)<br />
Wachtelweizen-Scheckenfalter (Mellicta athalia) 327 ,<br />
Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa), Wald-<br />
Mohrenfalter (E. aethiops) 328 : Larvallebensraum:<br />
krautig-grasige Vegetationsstrukturen unter halbschattigen,<br />
warmen Standortbedingungen in der<br />
Übergangszone Wald / Offenland bzw. im sehr lichten<br />
Waldbereich v. a. von Eichen-Mischwäldern 329 .<br />
Imaginalhabitat: voll besonnte, offene, aber windgeschützte<br />
Standorte im ungedüngten Magergrünland<br />
(WEIDEMANN 1988, BROCKMANN 1989).<br />
Kaisermantel (Argynnis paphia): Eiablage z. B. an<br />
die rissige Rinde von randständigen Eichen; Raupe<br />
an Veilchen im Waldsaum.<br />
Großer Perlmutterfalter (Mesoacidalia aglaja):<br />
Larvallebensraum: Veilchenarten an Störstellen im<br />
Grünland; die Falter an blütenreichen, besonders<br />
warmen <strong>Bereich</strong>en des Waldrandes; im Gebiet<br />
vielfach an Disteln, Flockenblume (Centaurea) und<br />
Brombeere.<br />
Veilchen-Perlmutterfalter (Clossiana euphrosyne):<br />
warme Saumbiotope (u. a. am Rande der Bachtäler<br />
oder auf Waldwiesen), wo die Raupenfutterpflanzen<br />
(Veilchenarten) vorkommen.<br />
326<br />
Als Urwaldrelikte werden von SCHIMMEL (1989) folgende Arten bezeichnet: Ampedus eleganthus (*), A. hijorty (*), A.<br />
cardinalis, A. fontisbellaquei (*), A. vandalitae (*), Brachygonus megerlei (*), Ischnodes sanguinicollis (in Rheinland-Pfalz<br />
ausgestorben), Procraeus tibialis (*), Lacon quercus (nur im Bienwald), Megapenthus lugens und Limoniscus violacens (die<br />
beiden letztgenannten Arten sind in Rheinland-Pfalz ausgestorben). Mit (*) gekennzeichnete Arten kommen im <strong>Bereich</strong> des<br />
Pfälzerwaldes vor.<br />
327<br />
Die Biotopkartierung gibt insgesamt 7 Fundorte des Wachtelweizen-Scheckenfalters an, die überwiegend in den Wiesentälern<br />
des Pfälzerwalds und dessen Randbereichen liegen. Einzelvorkommen sind im <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> für das NSG<br />
Wahlbacherheide und im <strong>Landkreis</strong> Kaiserslautern westlich von Frankelbach aufgeführt.<br />
328<br />
KRAUS (1993) nennt diese Art von mehreren Stellen im <strong>Planung</strong>sraum, fügt jedoch an, daß E. aethiops "in den letzten<br />
Jahren nicht mehr angetroffen" werden konnte.<br />
Nach EBERT & RENNWALD (1991) besiedelt der Wald-Mohrenfalter offene, sonnige Waldwege, Waldränder und Lichtungen<br />
in Laubmischwäldern sowie die angrenzenden trockenen oder feuchten Wiesen, wie beispielsweise Kohldistelwiesen oder<br />
Hochstaudenfluren in Wiesentälern. Weiterhin kommt die Art auch auf Wacholderheiden oder in Lichtungen von<br />
Trockenwäldern vor. DE LATTIN et al. (1957) zufolge soll E. aethiops v. a. an kühlere und feuchtere Biotope angepaßt sein,<br />
evtl. meinen die Autoren damit aber die Fundplätze der Imagines, die in den Wiesengesellschaften der feuchten Täler<br />
angetroffen wurden.<br />
329<br />
EBERT & RENNWALD (1991) dokumentieren als Raupenfutterpflanze von E. aethiops überwiegend Grasarten, die an<br />
magere, warm-trockene Standorte angepaßt sind.