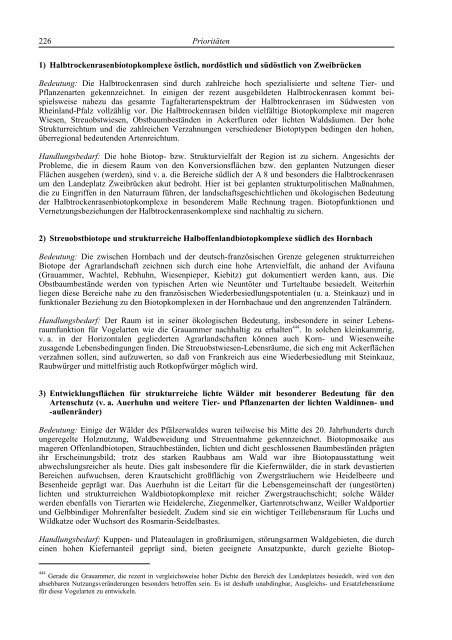Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
226 Prioritäten<br />
1) Halbtrockenrasenbiotopkomplexe östlich, nordöstlich und südöstlich von Zweibrücken<br />
Bedeutung: Die Halbtrockenrasen sind durch zahlreiche hoch spezialisierte und seltene Tier- und<br />
Pflanzenarten gekennzeichnet. In einigen der rezent ausgebildeten Halbtrockenrasen kommt beispielsweise<br />
nahezu das gesamte Tagfalterartenspektrum der Halbtrockenrasen im Südwesten von<br />
Rheinland-Pfalz vollzählig vor. Die Halbtrockenrasen bilden vielfältige Biotopkomplexe mit mageren<br />
Wiesen, Streuobstwiesen, Obstbaumbeständen in Ackerfluren oder lichten Waldsäumen. Der hohe<br />
Strukturreichtum und die zahlreichen Verzahnungen verschiedener Biotoptypen bedingen den hohen,<br />
überregional bedeutenden Artenreichtum.<br />
Handlungsbedarf: Die hohe Biotop- bzw. Strukturvielfalt der Region ist zu sichern. Angesichts der<br />
Probleme, die in diesem Raum von den Konversionsflächen bzw. den geplanten Nutzungen dieser<br />
Flächen ausgehen (werden), sind v. a. die <strong>Bereich</strong>e südlich der A 8 und besonders die Halbtrockenrasen<br />
um den Landeplatz Zweibrücken akut bedroht. Hier ist bei geplanten strukturpolitischen Maßnahmen,<br />
die zu Eingriffen in den Naturraum führen, der landschaftsgeschichtlichen und ökologischen Bedeutung<br />
der Halbtrockenrasenbiotopkomplexe in besonderem Maße Rechnung tragen. Biotopfunktionen und<br />
Vernetzungsbeziehungen der Halbtrockenrasenkomplexe sind nachhaltig zu sichern.<br />
2) Streuobstbiotope und strukturreiche Halboffenlandbiotopkomplexe südlich des Hornbach<br />
Bedeutung: Die zwischen Hornbach und der deutsch-französischen Grenze gelegenen strukturreichen<br />
Biotope der Agrarlandschaft zeichnen sich durch eine hohe Artenvielfalt, die anhand der Avifauna<br />
(Grauammer, Wachtel, Rebhuhn, Wiesenpieper, Kiebitz) gut dokumentiert werden kann, aus. Die<br />
Obstbaumbestände werden von typischen Arten wie Neuntöter und Turteltaube besiedelt. Weiterhin<br />
liegen diese <strong>Bereich</strong>e nahe zu den französischen Wiederbesiedlungspotentialen (u. a. Steinkauz) und in<br />
funktionaler Beziehung zu den Biotopkomplexen in der Hornbachaue und den angrenzenden Talrändern.<br />
Handlungsbedarf: Der Raum ist in seiner ökologischen Bedeutung, insbesondere in seiner Lebensraumfunktion<br />
für Vogelarten wie die Grauammer nachhaltig zu erhalten 444 . In solchen kleinkammrig,<br />
v. a. in der Horizontalen gegliederten Agrarlandschaften können auch Korn- und Wiesenweihe<br />
zusagende Lebensbedingungen finden. Die Streuobstwiesen-Lebensräume, die sich eng mit Ackerflächen<br />
verzahnen sollen, sind aufzuwerten, so daß von Frankreich aus eine Wiederbesiedlung mit Steinkauz,<br />
Raubwürger und mittelfristig auch Rotkopfwürger möglich wird.<br />
3) Entwicklungsflächen für strukturreiche lichte Wälder mit besonderer Bedeutung für den<br />
Artenschutz (v. a. Auerhuhn und weitere Tier- und Pflanzenarten der lichten Waldinnen- und<br />
-außenränder)<br />
Bedeutung: Einige der Wälder des Pfälzerwaldes waren teilweise bis Mitte des 20. Jahrhunderts durch<br />
ungeregelte Holznutzung, Waldbeweidung und Streuentnahme gekennzeichnet. Biotopmosaike aus<br />
mageren Offenlandbiotopen, Strauchbeständen, lichten und dicht geschlossenen Baumbeständen prägten<br />
ihr Erscheinungsbild; trotz des starken Raubbaus am Wald war ihre Biotopausstattung weit<br />
abwechslungsreicher als heute. Dies galt insbesondere für die Kiefernwälder, die in stark devastierten<br />
<strong>Bereich</strong>en aufwuchsen, deren Krautschicht großflächig von Zwergsträuchern wie Heidelbeere und<br />
Besenheide geprägt war. Das Auerhuhn ist die Leitart für die Lebensgemeinschaft der (ungestörten)<br />
lichten und strukturreichen Waldbiotopkomplexe mit reicher Zwergstrauchschicht; solche Wälder<br />
werden ebenfalls von Tierarten wie Heidelerche, Ziegenmelker, Gartenrotschwanz, Weißer Waldportier<br />
und Gelbbindiger Mohrenfalter besiedelt. Zudem sind sie ein wichtiger Teillebensraum für Luchs und<br />
Wildkatze oder Wuchsort des Rosmarin-Seidelbastes.<br />
Handlungsbedarf: Kuppen- und Plateaulagen in großräumigen, störungsarmen Waldgebieten, die durch<br />
einen hohen Kiefernanteil geprägt sind, bieten geeignete Ansatzpunkte, durch gezielte Biotop-<br />
444 Gerade die Grauammer, die rezent in vergleichsweise hoher Dichte den <strong>Bereich</strong> des Landeplatzes besiedelt, wird von den<br />
absehbaren Nutzungsveränderungen besonders betroffen sein. Es ist deshalb unabdingbar, Ausgleichs- und Ersatzlebensräume<br />
für diese Vogelarten zu entwickeln.