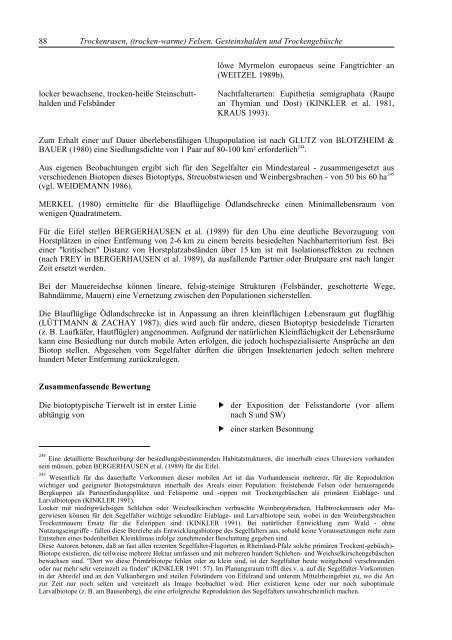Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
88 Trockenrasen, (trocken-warme) Felsen, Gesteinshalden und Trockengebüsche<br />
locker bewachsene, trocken-heiße Steinschutthalden<br />
und Felsbänder<br />
löwe Myrmelon europaeus seine Fangtrichter an<br />
(WEITZEL 1989b).<br />
Nachtfalterarten: Eupithetia semigraphata (Raupe<br />
an Thymian und Dost) (KINKLER et al. 1981,<br />
KRAUS 1993).<br />
Zum Erhalt einer auf Dauer überlebensfähigen Uhupopulation ist nach GLUTZ von BLOTZHEIM &<br />
BAUER (1980) eine Siedlungsdichte von 1 Paar auf 80-100 km² erforderlich 244 .<br />
Aus eigenen Beobachtungen ergibt sich für den Segelfalter ein Mindestareal - zusammengesetzt aus<br />
verschiedenen Biotopen dieses Biotoptyps, Streuobstwiesen und Weinbergsbrachen - von 50 bis 60 ha 245<br />
(vgl. WEIDEMANN 1986).<br />
MERKEL (1980) ermittelte für die Blauflügelige Ödlandschrecke einen Minimallebensraum von<br />
wenigen Quadratmetern.<br />
Für die Eifel stellen BERGERHAUSEN et al. (1989) für den Uhu eine deutliche Bevorzugung von<br />
Horstplätzen in einer Entfernung von 2-6 km zu einem bereits besiedelten Nachbarterritorium fest. Bei<br />
einer "kritischen" Distanz von Horstplatzabständen über 15 km ist mit Isolationseffekten zu rechnen<br />
(nach FREY in BERGERHAUSEN et al. 1989), da ausfallende Partner oder Brutpaare erst nach langer<br />
Zeit ersetzt werden.<br />
Bei der Mauereidechse können lineare, felsig-steinige Strukturen (Felsbänder, geschotterte Wege,<br />
Bahndämme, Mauern) eine Vernetzung zwischen den Populationen sicherstellen.<br />
Die Blauflüglige Ödlandschrecke ist in Anpassung an ihren kleinflächigen Lebensraum gut flugfähig<br />
(LÜTTMANN & ZACHAY 1987); dies wird auch für andere, diesen Biotoptyp besiedelnde Tierarten<br />
(z. B. Laufkäfer, Hautflügler) angenommen. Aufgrund der natürlichen Kleinflächigkeit der Lebensräume<br />
kann eine Besiedlung nur durch mobile Arten erfolgen, die jedoch hochspezialisierte Ansprüche an den<br />
Biotop stellen. Abgesehen vom Segelfalter dürften die übrigen Insektenarten jedoch selten mehrere<br />
hundert Meter Entfernung zurückzulegen.<br />
Zusammenfassende Bewertung<br />
Die biotoptypische Tierwelt ist in erster Linie<br />
abhängig von<br />
� der Exposition der Felsstandorte (vor allem<br />
nach S und SW)<br />
� einer starken Besonnung<br />
244<br />
Eine detaillierte Beschreibung der besiedlungsbestimmenden Habitatstrukturen, die innerhalb eines Uhureviers vorhanden<br />
sein müssen, geben BERGERHAUSEN et al. (1989) für die Eifel.<br />
245<br />
Wesentlich für das dauerhafte Vorkommen dieser mobilen Art ist das Vorhandensein mehrerer, für die Reproduktion<br />
wichtiger und geeigneter Biotopstrukturen innerhalb des Areals einer Population: freistehende Felsen oder herausragende<br />
Bergkuppen als Partnerfindungsplätze und Felssporne und -rippen mit Trockengebüschen als primären Eiablage- und<br />
Larvalbiotopen (KINKLER 1991).<br />
Locker mit niedrigwüchsigen Schlehen oder Weichselkirschen verbuschte Weinbergsbrachen, Halbtrockenrasen oder Magerwiesen<br />
können für den Segelfalter wichtige sekundäre Eiablage- und Larvalbiotope sein, wobei in den Weinbergsbrachen<br />
Trockenmauern Ersatz für die Felsrippen sind (KINKLER 1991). Bei natürlicher Entwicklung zum Wald - ohne<br />
Nutzungseingriffe - fallen diese <strong>Bereich</strong>e als Entwicklungsbiotope des Segelfalters aus, sobald keine Voraussetzungen mehr zum<br />
Entstehen eines bodenheißen Kleinklimas infolge zunehmender Beschattung gegeben sind.<br />
Diese Autoren betonen, daß an fast allen rezenten Segelfalter-Flugorten in Rheinland-Pfalz solche primären Trocken(-gebüsch)-<br />
Biotope existieren, die teilweise mehrere Hektar umfassen und mit mehreren hundert Schlehen- und Weichselkirschengebüschen<br />
bewachsen sind. "Dort wo diese Primärbiotope fehlen oder zu klein sind, ist der Segelfalter heute weitgehend verschwunden<br />
oder nur mehr sehr vereinzelt zu finden" (KINKLER 1991: 57). Im <strong>Planung</strong>sraum trifft dies v. a. auf die Segelfalter-Vorkommen<br />
in der Ahreifel und an den Vulkanbergen und steilen Felsrändern von Eifelrand und unterem Mittelrheingebiet zu, wo die Art<br />
zur Zeit nur noch selten und vereinzelt als Imago beobachtet wird. Hier existieren keine oder nur noch suboptimale<br />
Larvalbiotope (z. B. am Bausenberg), die eine erfolgreiche Reproduktion des Segelfalters unwahrscheinlich machen.