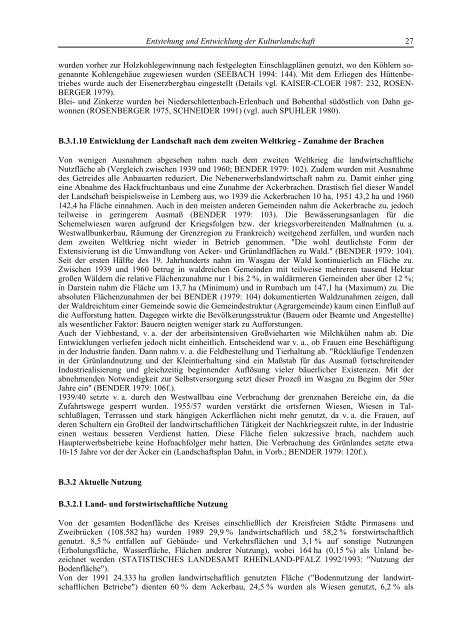Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 27<br />
wurden vorher zur Holzkohlegewinnung nach festgelegten Einschlagplänen genutzt, wo den Köhlern sogenannte<br />
Kohlengehäue zugewiesen wurden (SEEBACH 1994: 144). Mit dem Erliegen des Hüttenbetriebes<br />
wurde auch der Eisenerzbergbau eingestellt (Details vgl. KAISER-CLOER 1987: 232, ROSEN-<br />
BERGER 1979).<br />
Blei- und Zinkerze wurden bei Niederschlettenbach-Erlenbach und Bobenthal südöstlich von Dahn gewonnen<br />
(ROSENBERGER 1975, SCHNEIDER 1991) (vgl. auch SPUHLER 1980).<br />
B.3.1.10 Entwicklung der Landschaft nach dem zweiten Weltkrieg - Zunahme der Brachen<br />
Von wenigen Ausnahmen abgesehen nahm nach dem zweiten Weltkrieg die landwirtschaftliche<br />
Nutzfläche ab (Vergleich zwischen 1939 und 1960; BENDER 1979: 102). Zudem wurden mit Ausnahme<br />
des Getreides alle Anbauarten reduziert. Die Nebenerwerbslandwirtschaft nahm zu. Damit einher ging<br />
eine Abnahme des Hackfruchtanbaus und eine Zunahme der Ackerbrachen. Drastisch fiel dieser Wandel<br />
der Landschaft beispielsweise in Lemberg aus, wo 1939 die Ackerbrachen 10 ha, 1951 43,2 ha und 1960<br />
142,4 ha Fläche einnahmen. Auch in den meisten anderen Gemeinden nahm die Ackerbrache zu, jedoch<br />
teilweise in geringerem Ausmaß (BENDER 1979: 103). Die Bewässerungsanlagen für die<br />
Schemelwiesen waren aufgrund der Kriegsfolgen bzw. der kriegsvorbereitenden Maßnahmen (u. a.<br />
Westwallbunkerbau, Räumung der Grenzregion zu Frankreich) weitgehend zerfallen, und wurden nach<br />
dem zweiten Weltkrieg nicht wieder in Betrieb genommen. "Die wohl deutlichste Form der<br />
Extensivierung ist die Umwandlung von Acker- und Grünlandflächen zu Wald." (BENDER 1979: 104).<br />
Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm im Wasgau der Wald kontinuierlich an Fläche zu.<br />
Zwischen 1939 und 1960 betrug in waldreichen Gemeinden mit teilweise mehreren tausend Hektar<br />
großen Wäldern die relative Flächenzunahme nur 1 bis 2 %, in waldärmeren Gemeinden aber über 12 %;<br />
in Darstein nahm die Fläche um 13,7 ha (Minimum) und in Rumbach um 147,1 ha (Maximum) zu. Die<br />
absoluten Flächenzunahmen der bei BENDER (1979: 104) dokumentierten Waldzunahmen zeigen, daß<br />
der Waldreichtum einer Gemeinde sowie die Gemeindestruktur (Agrargemeinde) kaum einen Einfluß auf<br />
die Aufforstung hatten. Dagegen wirkte die Bevölkerungsstruktur (Bauern oder Beamte und Angestellte)<br />
als wesentlicher Faktor: Bauern neigten weniger stark zu Aufforstungen.<br />
Auch der Viehbestand, v. a. der der arbeitsintensiven Großvieharten wie Milchkühen nahm ab. Die<br />
Entwicklungen verliefen jedoch nicht einheitlich. Entscheidend war v. a., ob Frauen eine Beschäftigung<br />
in der Industrie fanden. Dann nahm v. a. die Feldbestellung und Tierhaltung ab. "Rückläufige Tendenzen<br />
in der Grünlandnutzung und der Kleintierhaltung sind ein Maßstab für das Ausmaß fortschreitender<br />
Industriealisierung und gleichzeitig beginnender Auflösung vieler bäuerlicher Existenzen. Mit der<br />
abnehmenden Notwendigkeit zur Selbstversorgung setzt dieser Prozeß im Wasgau zu Beginn der 50er<br />
Jahre ein" (BENDER 1979: 106f.).<br />
1939/40 setzte v. a. durch den Westwallbau eine Verbrachung der grenznahen <strong>Bereich</strong>e ein, da die<br />
Zufahrtswege gesperrt wurden. 1955/57 wurden verstärkt die ortsfernen Wiesen, Wiesen in Talschlußlagen,<br />
Terrassen und stark hängigen Ackerflächen nicht mehr genutzt, da v. a. die Frauen, auf<br />
deren Schultern ein Großteil der landwirtschaftlichen Tätigkeit der Nachkriegszeit ruhte, in der Industrie<br />
einen weitaus besseren Verdienst hatten. Diese Fläche fielen sukzessive brach, nachdem auch<br />
Haupterwerbsbetriebe keine Hofnachfolger mehr hatten. Die Verbrachung des Grünlandes setzte etwa<br />
10-15 Jahre vor der der Äcker ein (Landschaftsplan Dahn, in Vorb.; BENDER 1979: 120f.).<br />
B.3.2 Aktuelle Nutzung<br />
B.3.2.1 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung<br />
Von der gesamten Bodenfläche des Kreises einschließlich der Kreisfreien Städte Pirmasens und<br />
Zweibrücken (108.582 ha) wurden 1989 29,9 % landwirtschaftlich und 58,2 % forstwirtschaftlich<br />
genutzt. 8,5 % entfallen auf Gebäude- und Verkehrsflächen und 3,1 % auf sonstige Nutzungen<br />
(Erholungsfläche, Wasserfläche, Flächen anderer Nutzung), wobei 164 ha (0,15 %) als Unland bezeichnet<br />
werden (STATISTISCHES LANDESAMT RHEINLAND-PFALZ 1992/1993: "Nutzung der<br />
Bodenfläche").<br />
Von der 1991 24.333 ha großen landwirtschaftlich genutzten Fläche ("Bodennutzung der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe") dienten 60 % dem Ackerbau, 24,5 % wurden als Wiesen genutzt, 6,2 % als