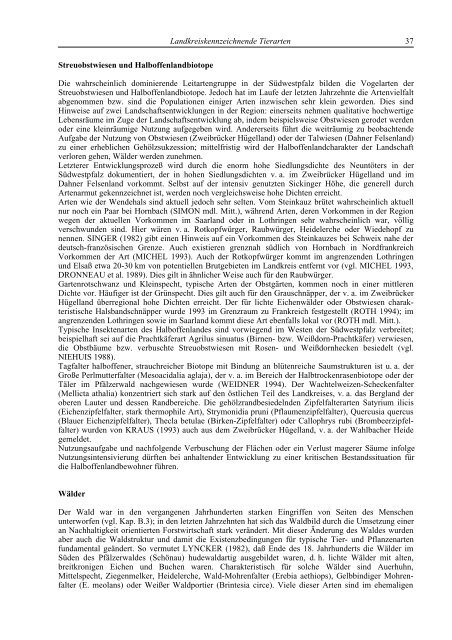Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Streuobstwiesen und Halboffenlandbiotope<br />
<strong>Landkreis</strong>kennzeichnende Tierarten 37<br />
Die wahrscheinlich dominierende Leitartengruppe in der <strong>Südwestpfalz</strong> bilden die Vogelarten der<br />
Streuobstwiesen und Halboffenlandbiotope. Jedoch hat im Laufe der letzten Jahrzehnte die Artenvielfalt<br />
abgenommen bzw. sind die Populationen einiger Arten inzwischen sehr klein geworden. Dies sind<br />
Hinweise auf zwei Landschaftsentwicklungen in der Region: einerseits nehmen qualitative hochwertige<br />
Lebensräume im Zuge der Landschaftsentwicklung ab, indem beispielsweise Obstwiesen gerodet werden<br />
oder eine kleinräumige Nutzung aufgegeben wird. Andererseits führt die weiträumig zu beobachtende<br />
Aufgabe der Nutzung von Obstwiesen (Zweibrücker Hügelland) oder der Talwiesen (Dahner Felsenland)<br />
zu einer erheblichen Gehölzsukzession; mittelfristig wird der Halboffenlandcharakter der Landschaft<br />
verloren gehen, Wälder werden zunehmen.<br />
Letzterer Entwicklungsprozeß wird durch die enorm hohe Siedlungsdichte des Neuntöters in der<br />
<strong>Südwestpfalz</strong> dokumentiert, der in hohen Siedlungsdichten v. a. im Zweibrücker Hügelland und im<br />
Dahner Felsenland vorkommt. Selbst auf der intensiv genutzten Sickinger Höhe, die generell durch<br />
Artenarmut gekennzeichnet ist, werden noch vergleichsweise hohe Dichten erreicht.<br />
Arten wie der Wendehals sind aktuell jedoch sehr selten. Vom Steinkauz brütet wahrscheinlich aktuell<br />
nur noch ein Paar bei Hornbach (SIMON mdl. Mitt.), während Arten, deren Vorkommen in der Region<br />
wegen der aktuellen Vorkommen im Saarland oder in Lothringen sehr wahrscheinlich war, völlig<br />
verschwunden sind. Hier wären v. a. Rotkopfwürger, Raubwürger, Heidelerche oder Wiedehopf zu<br />
nennen. SINGER (1982) gibt einen Hinweis auf ein Vorkommen des Steinkauzes bei Schweix nahe der<br />
deutsch-französischen Grenze. Auch existieren grenznah südlich von Hornbach in Nordfrankreich<br />
Vorkommen der Art (MICHEL 1993). Auch der Rotkopfwürger kommt im angrenzenden Lothringen<br />
und Elsaß etwa 20-30 km von potentiellen Brutgebieten im <strong>Landkreis</strong> entfernt vor (vgl. MICHEL 1993,<br />
DRONNEAU et al. 1989). Dies gilt in ähnlicher Weise auch für den Raubwürger.<br />
Gartenrotschwanz und Kleinspecht, typische Arten der Obstgärten, kommen noch in einer mittleren<br />
Dichte vor. Häufiger ist der Grünspecht. Dies gilt auch für den Grauschnäpper, der v. a. im Zweibrücker<br />
Hügelland überregional hohe Dichten erreicht. Der für lichte Eichenwälder oder Obstwiesen charakteristische<br />
Halsbandschnäpper wurde 1993 im Grenzraum zu Frankreich festgestellt (ROTH 1994); im<br />
angrenzenden Lothringen sowie im Saarland kommt diese Art ebenfalls lokal vor (ROTH mdl. Mitt.).<br />
Typische Insektenarten des Halboffenlandes sind vorwiegend im Westen der <strong>Südwestpfalz</strong> verbreitet;<br />
beispielhaft sei auf die Prachtkäferart Agrilus sinuatus (Birnen- bzw. Weißdorn-Prachtkäfer) verwiesen,<br />
die Obstbäume bzw. verbuschte Streuobstwiesen mit Rosen- und Weißdornhecken besiedelt (vgl.<br />
NIEHUIS 1988).<br />
Tagfalter halboffener, strauchreicher Biotope mit Bindung an blütenreiche Saumstrukturen ist u. a. der<br />
Große Perlmutterfalter (Mesoacidalia aglaja), der v. a. im <strong>Bereich</strong> der Halbtrockenrasenbiotope oder der<br />
Täler im Pfälzerwald nachgewiesen wurde (WEIDNER 1994). Der Wachtelweizen-Scheckenfalter<br />
(Mellicta athalia) konzentriert sich stark auf den östlichen Teil des <strong>Landkreis</strong>es, v. a. das Bergland der<br />
oberen Lauter und dessen Randbereiche. Die gehölzrandbesiedelnden Zipfelfalterarten Satyrium ilicis<br />
(Eichenzipfelfalter, stark thermophile Art), Strymonidia pruni (Pflaumenzipfelfalter), Quercusia quercus<br />
(Blauer Eichenzipfelfalter), Thecla betulae (Birken-Zipfelfalter) oder Callophrys rubi (Brombeerzipfelfalter)<br />
wurden von KRAUS (1993) auch aus dem Zweibrücker Hügelland, v. a. der Wahlbacher Heide<br />
gemeldet.<br />
Nutzungsaufgabe und nachfolgende Verbuschung der Flächen oder ein Verlust magerer Säume infolge<br />
Nutzungsintensivierung dürften bei anhaltender Entwicklung zu einer kritischen Bestandssituation für<br />
die Halboffenlandbewohner führen.<br />
Wälder<br />
Der Wald war in den vergangenen Jahrhunderten starken Eingriffen von Seiten des Menschen<br />
unterworfen (vgl. Kap. B.3); in den letzten Jahrzehnten hat sich das Waldbild durch die Umsetzung einer<br />
an Nachhaltigkeit orientierten Forstwirtschaft stark verändert. Mit dieser Änderung des Waldes wurden<br />
aber auch die Waldstruktur und damit die Existenzbedingungen für typische Tier- und Pflanzenarten<br />
fundamental geändert. So vermutet LYNCKER (1982), daß Ende des 18. Jahrhunderts die Wälder im<br />
Süden des Pfälzerwaldes (Schönau) hudewaldartig ausgebildet waren, d. h. lichte Wälder mit alten,<br />
breitkronigen Eichen und Buchen waren. Charakteristisch für solche Wälder sind Auerhuhn,<br />
Mittelspecht, Ziegenmelker, Heidelerche, Wald-Mohrenfalter (Erebia aethiops), Gelbbindiger Mohrenfalter<br />
(E. meolans) oder Weißer Waldportier (Brintesia circe). Viele dieser Arten sind im ehemaligen